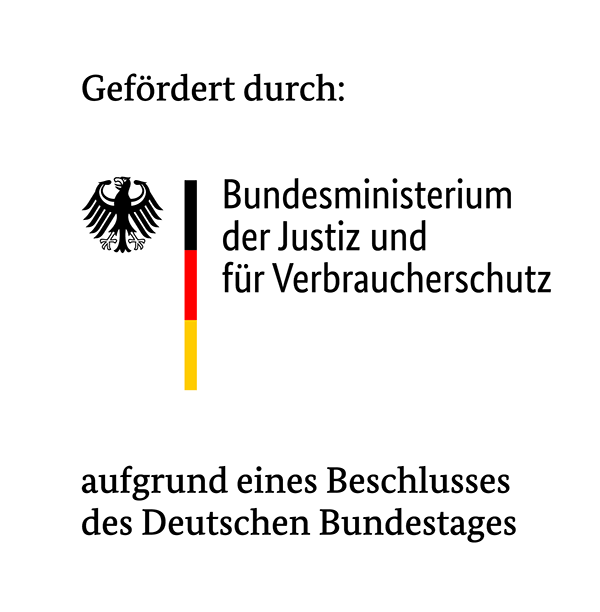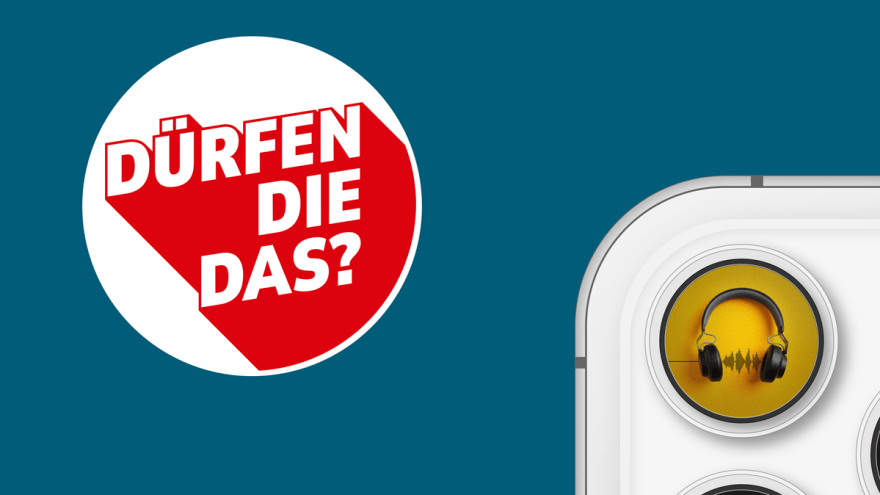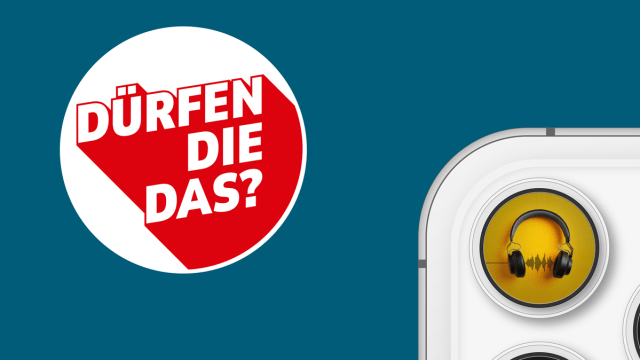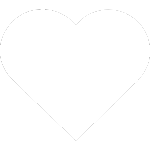Gute Nachrichten in schlechter Gesellschaft und warum Influencer-Werbung für Unternehmen so sexy ist
Wenn man schon Gaming-YouTubern im Zuckerrausch und Instastars im Esoterikwahn nicht glauben dann, dann doch wenigstens der seriösen Presse - oder? Ja und nein. Denn selbst gut recherchierte News im Netz leben oft Tür an Tür mit werblichen Angeboten, die sich als Journalismus ausgeben. Außerdem: Ein wissenschaftlicher Blick auf die Gründe, warum immer mehr Unternehmen auf Influencer setzen und wie sich die heutigen Online-Werbeträger*innen von Prominenten in der TV- und Zeitschriftenwerbung von früher unterscheiden.
Diesmal mit den Expert:innen: Martin Schwarzbeck (netzpolitik.org), Prof. Dr. Kristina Klein (Universität Bremen), Dr. Susanne Punsmann (Verbraucherzentrale NRW) und Andre Wolf (mimikama.org). Moderation & Produktion: Patrick Lohmeier (Verbraucherzentrale Berlin).
dürfen die das? wird gefördert durch das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestags.
Wir freuen uns über Lob, Kritik und Themenwünsche per E-Mail an podcast@vz-bln.de. Weitere Informationen zum Podcast und alle Episoden finden Sie unter verbraucherzentrale.de/dddpodcast.
Quellen:
- netzpolitik.org Homepage
- Homepage des markstones Institute of Marketing, Branding and Technology an der Universität Bremen (uni-bremen.de)
- mimikama.org Homepage
- So gefährlich und verbreitet ist Werbung, die wie Journalismus aussieht (netzpolitik.org, 3. März 2025)
- Faktencheck Gesundheitswerbung (Gesundheitlicher Verbraucherschutz im digitalen Health-Style-Markt) auf Verbraucherzentrale.de
- Machen Journalisten jetzt eigenlich PR - oder nicht? (Übermedien.de, 27. September 2024)
- @morenutition.de: "Lauft nicht, RENNT!" (TikTok, 7. Oktober 2024)
- @ViniciusCavalieriSa: "Breaking Bad Main Title Theme Cover" (YouTube, 17. September 2019)
- @carlottbru: Werbung für Saltletts (Instagram, 23. September 2024)
- @yello_de: Werbung für Stromanbieter mit Carlott Bru (Instagram, 11. März 2024)
- @007: "No Time to Die - Worth the Wait" (YouTube, 15. September 2021)
- @AliciaJoe: Warum jeder Influencer jetzt für TEMU wirbt..." (YouTube, 18. September 2023)
Ganze Folge zum Nachlesen
- Hier klicken, um das Transkript zu öffnen...
[CLIP]
Patrick Lohmeier:
[0:32] Falls irgendjemand da draußen sich versucht gefühlt hatte, mich als Werbe-Influencer für Frühstücksflocken oder irgendein anderes Produkt zu engagieren, der oder dem konnte ich diese Idee mit meinem kleinen Selbstversuch hoffentlich austreiben. Denn bei aller in diesem Podcast geäußerten Kritik an den Botschaften und Methoden hinter unseriöser Werbung in sozialen Netzwerken, muss ich auch fast immer neidlos anerkennen, dass diese Reels und Posts und TikToks und Storys schon sehr gut gemacht sind. Also zumindest sehr viel besser als das, was sie da gerade von mir gehört haben.Patrick Lohmeier:
[1:10] Das gilt gleichermaßen für die Fake-Gewinnspiele bei Facebook, mit denen wir unsere Reihe begonnen haben. Oder im Speziellen eben dieses Gewinnspiel für ein High-End Wohnmobil, das letztes Jahr bei YouTube und Facebook herumgeisterte und bei dem man nichts gewinnen, sondern im schlimmsten Fall nur all seine persönlichen Daten an kriminelle Banden verlieren konnte. [...] Entschuldigung, ich komme einfach nicht darüber hinweg. Also deswegen nochmal ganz deutlich. Das war eine super authentisch wirkende Anzeige und der Anbieter mutmaßlich die größte Discounterkette Deutschlands. Und da ging es eben auch um ein echtes Deluxe-Wohnmobil. Ich meine, nicht nur so einen kleinen Bulli mit einer Pritsche und auch keinen riesigen, cremefarbenen Schuhkarton. Also so einen, in dem Walter White in der Serie Breaking Bad seine Drogen kocht.Patrick Lohmeier:
[2:31] Nein, es war so ein richtig schicker Bolide, weltbekannte Marke, blaugraues Metallic, dicke Offroad-Reifen, luxuriöse Ausstattung und, und, und. Ich meine, brauchte ich das damals wie heute? Nicht wirklich.Patrick Lohmeier:
[2:46] Klimafreundlich? Mit Sicherheit nicht. Und eine Antwort auf die Frage, wo ich den parke, kann ich auch nur begegnen mit, ja, keine Ahnung. Und dennoch, ich klicke mal drauf. Oder ich klickte mal drauf, weil ich Vertrauen in den Anbieter hatte. Weil die Anzeige ein Bedürfnis oder einen Wunsch bediente. Weil die Webseite, auf der ich mich gerade befinde oder befand, YouTube, doch sonst so gut darin ist, mir genau das anzuzeigen, was mich interessiert. Ich möchte diese Triggerpunkte in der Online-Werbung, also die ausschlaggebenden Kräfte, die dafür sorgen, dass sie auf eine Anzeige klicken oder an einem Gewinnspiel teilnehmen, ob Fake oder nicht, oder einem Influencer etwas abkaufen, von dessen Mehrwert wir vielleicht gar nicht so wirklich überzeugt sind, auch in der heutigen Episode aufgreifen. Also Auslöser wie ein persönlicher Bedarf oder ein Vertrauen in den Anbieter oder den Menschen dahinter und natürlich auch der niedrigschwellige Zugang, den uns die Online-Welt bietet.Patrick Lohmeier:
[3:46] Und zwar möchte ich diesmal nach solchen Klick- und Tipp-Impulsen und den dazugehörigen Werbeangeboten, die uns dazu verführen, dort in der Online-Welt suchen, wo viele Menschen, also ich zumindest, diese nicht sofort vermuten. Weil ich finde, dass es viel zu einfach, weil viel zu naheliegend wäre, in dieser Reihe nur auf miese Online-Scams zu gucken, die ja maßgeschneidert sind für eine vermeintlich ältere Zielgruppe. Oder auf die wunderschönen Gesichter und Körper bei Insta und TikTok, die uns ihre Pillen, Cremes und Cryptocoins verkaufen wollen.[CLIP]
Patrick Lohmeier:
[4:27] Deswegen lassen Sie uns zum Thema Online-Werbung auch mal dorthin blicken, wo wir aktuelle, fundiert recherchierte und glaubwürdige Berichterstattung erwarten - und sie meist auch kriegen. Nämlich bei großen Nachrichtenportalen. Bevor ich mit dieser Ankündigung auf den Inhalt der heutigen Folge Bilder von Menschen heraufbeschwöre, die wütend ihre Fackeln und Mistgabeln schwingen und "Lügenpresse!" schreien. Nein, nein, nein. Heute geht es bei "dürfen die das?" das nicht um Fake News, sondern um in aller Regel guten Journalismus, der mit fragwürdiger Online-Werbung aber Tür an Tür leben muss. Klingt komisch, aber sie kennen das sicher. Seine Nachbarn kann man sich nicht aussuchen und wenn die Harmonie nicht stimmt, lebt man eben in Zwietracht vereint. Heute also bei "dürfen die das?": Bad News Alert. Mein Name ist Patrick Lohmeier von der Verbraucherzentrale Berlin und hier ist unser musikalischer Nachrichtenticker.[CLIP]
Patrick Lohmeier:
[5:56] Ja. Chapeau. Kann ich nur sagen. So geht das mit dem Müsli bei Instagram. Ich hatte am Ende der letzten Episode Mats Schönauer erwähnt, als Journalist, dessen Arbeit ich seit vielen Jahren schätze. Und ich hatte auch erwähnt, dass es mir nicht unbedingt gefiel, dass er seine YouTube-Beiträge neuerdings unterbricht, um für Getränkepulver zu werben. Auch Carlott Bru ist Journalistin, Freijournalistin und Content-Creatorin und wenn sie nicht für die SZ, Zeit Online oder den Spiegel schreibt, macht sie schon mal bezahlte Werbung für einen Backwarenkonzern oder wie hier für einen Stromanbieter.[CLIP]
Patrick Lohmeier:
[7:05] Carlott Bru, ihren Namen spreche ich hoffentlich korrekt aus, kenne ich erst seit einem Artikel auf übermedien.de. Übermedien.de ist ein Online-Journal, das, wie es der Name schon sagt, kritisch über Rundfunk, Print und Online-Medien berichtet. Da geht es auch gerne einmal um Werbung. Vor allem, wenn sie eben dort aufschlägt, wo sie nicht hingehört. Und in dem von mir angesprochenen Beitrag ging es um Bru. Und das Problem mit der Trennung von Journalismus und PR, will heißen, der Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunternehmen. Also früher hieß es meist, wer einmal mit der Werbeindustrie ins Bett steige, der oder die sei für den Journalismus quasi verbrannt und verloren. Jetzt ist aber nicht mehr früher und gerade bei freiberuflichen Journalistinnen und Journalisten, die Social Media für sich entdeckt haben und nutzen und ebenso gut wie nie auf ein festes Einkommen bauen können, sind diese bezahlten Werbepartnerschaften ein willkommenes Zubrot. Für eine differenzierte Berichterstattung dazu verweise ich an den Übermedienbeitrag von Alexander Graf, den ich im Begleittext zu dieser Folge verlinke.Patrick Lohmeier:
[8:10] Darin wird auch die Ansicht formuliert, dass sofern eine strikte inhaltliche Trennung zwischen dem beworbenen Produkt oder Unternehmen und der journalistischen Arbeit des Menschen, der eben für dieses Produkt oder Unternehmen Werbung macht, gewährleistet ist, solche Werbebotschaften schon klar gehen. Deswegen blicke ich durchaus mit Verständnis auf, naja, wie soll ich es nennen, Journalismus-Influencer-Werbung, wie sie Schönauer in seinem YouTube-Channel "Topf voll Gold" und Carlott Bru bei Instagram praktizieren, und sehe da erst einmal kein nennenswertes Risiko für Verbraucherinnen und Verbraucher. Weil die Werbung ist klar als solch gekennzeichnet, die Hintergründe zu den Werbepartnerschaften werden einigermaßen transparent umrissen, und die Newsfluencer bewerben nichts, mit dem sie sich in der Regel in ihrer journalistischen Arbeit auseinandersetzen. Es gibt also keinen unmittelbaren Interessenkonflikt. Den gibt es im Umfeld des Online-Journalismus und der Nachrichtenportale gerade ganz woanders. Zumindest ist Martin Schwarzbeck von Netzpolitik.org diese Auffassung. Und deswegen habe ich ihn in den Redaktionsräumen des nach Eigenauskunft "Mediums für digitale Freiheitsrechte" besucht.Martin Schwarzbeck:
[9:24] Das heißt, wir schreiben am meisten über Angreifer und Verteidiger der Bürgerrechte im Netz. Das hat ganz viel mit Überwachung zu tun. Also Überwachung durch Staaten, sowas wie Chatkontrolle, automatisierte Gesichtserkennung, Vorratsdatenspeicherung und so, aber auch Überwachung durch Firmen, Datenkapitalismus oder auch Werbe-ID. Es gibt ja so einen ganz persönlich zuordnenbaren Identifikator, den du mit deinem Telefon immer durch die Welt schickst, womit dann Werbefirmen dich verfolgen, Profile aufbauen. Ein ganz breites Themenfeld.Patrick Lohmeier:
[10:06] Mit eurer Arbeit, mit eurem Journalismus, richtet ihr euch da vor allem an die Politik, an Konzerne oder tatsächlich am Ende an die Menschen, die am Ende dieser digital-medialen Verwertungsketten stehen?Martin Schwarzbeck:
[10:21] Ja, ja, klar. Ganz klar sind wir auf der Seite der Verbraucherinnen und Verbraucher. Das ist auch in unserer Satzung festgeschrieben. Wir betreiben Verbraucherschutz und schreiben für die Menschen, die digitale Angebote wahrnehmen.Patrick Lohmeier:
[10:44] Was ist denn Native Advertising?Martin Schwarzbeck:
[10:47] Man kennt das auch als Advertorial. Das ist eigentlich eine Geschichte, die gab es auch schon in den Printmedien. Das ist so, wenn journalistische Beiträge, also Interviews, Nachrichten, Reportagen, so aussehen, als seien sie solche journalistischen Beiträge, aber in Wahrheit ist das Werbung. Also Werbung, die wie Journalismus aussieht. Und das ist im Internet eine relativ neue Geschichte. So vor zehn Jahren gab es das noch überhaupt nicht. Aber mittlerweile ist das ein Riesending. Das machen alle. Also im Prinzip machen das fast alle großen Medien, Nachrichtenportale, betreiben Native Advertising. Und das Krasseste daran ist, niemand berichtet darüber, weil eben alle selber drin verwickelt sind. Für Werbetreibende hat das ein paar relativ naheliegende Vorteile. Das wird nicht so schnell weggeklickt, weil unsere Gehirne sind schon relativ gut durch das Internet so drauf gebrieft, dass sie eine Anzeige erkennen. So diese große bunte Fläche, das ist gleich klar, das ist eine Anzeige. Und die blenden wir komplett aus, unterbewusst. Aber wenn das dann Texte sind, die erstmal aussehen wie jeder andere Text in der Plattform, auf der ich ja gerade Texte lesen möchte, dann ist das was ganz anderes. Dann nimmt man das viel eher wahr. Und die Idee ist, dass die Werbetreibenden so an der Seriosität des Mediums teilnehmen, bei dem sie werben. So wenn ich dann jetzt bei Spiegel irgendwie meine Werbung schalte, sieht aus wie ein redaktioneller Text und die Leute denken, es ist ein Spiegeltext, dass ich damit dann die Seriosität des Mediums abgreife.Martin Schwarzbeck:
[12:28] Es ist ja so, dass die Trennung zwischen Anzeigenabteilung und Redaktion, das ist ja eine ganz grundlegende. Nur aufgrund der kann ja unabhängige Berichterstattung funktionieren. Ich kenne das von früher so, die Redaktion hat nicht mal mit den Menschen aus der Anzeigenabteilung gesprochen, weil die sich so deutlich davon abgegrenzt haben. Aber diese zwei Bereiche, die fließen eben zurzeit immer deutlicher ineinander.Patrick Lohmeier:
[12:53] Ja, diese redaktionellen Werbeinhalte, die gab es ja auch, ich möchte sagen immer, aber die gibt es schon sehr, sehr lange Zeit. Wenn ich da so an die Postillen und an die Klatschblätter denke, die meine Großmutter gelesen hat, ich möchte es hier überhaupt keine Namen nennen, die waren ja voll davon. Ist das nochmal so eine neue Qualität, wenn wir von Native Advertising oder diesen Advertorials im Online-Zusammenhang reden oder ist es im Grunde das Gleiche einfach nur mit modernen technischen Mitteln?Martin Schwarzbeck:
[13:18] Es ist ja auch so, dass große, seriöse Zeitungen oder Wochenmagazine hatten ja oft auch so Sonderveröffentlichungen schon im Print. Genau, diese Beilagen. Das ist eine komplette Beilage zum Thema Wohnen und Einrichten. Die ist im Prinzip voll mit Werbung und vorne drauf steht "Verlagsangebot", vielleicht noch "in Kooperation mit". Das gibt es schon immer. Das Besondere, was jetzt neu ist, ist einmal die Dimension. Das ist unglaublich groß geworden, dieses Geschäft und auch, dass die Grenze nicht mehr so strikt eingehalten wird. Also das ist so ein bisschen, da könnte man sich dann vorstellen, als würde dann so ein Beitrag aus dieser Beilage, der ja nicht umsonst in diese Beilage ausgelagert worden war, dann plötzlich auf die Titelseite rutschen.Patrick Lohmeier:
[14:04] Wir haben vorab schon mal telefoniert und du hast mir erzählt, es ist euch auch aus eigener Erfahrung nicht gänzlich unbekannt, dass Menschen auf euch zukommen und sagen "Ihr habt da eine schöne Webseite", sage ich jetzt mal ganz blöd, "mit einer ordentlichen Reichweite und wahrscheinlich eine treue Leserschaft. Wie wäre es denn mal mit schönen werblichen Inhalten auf eurer Seite?" Kannst du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was dir in deiner Arbeit und deinen Kolleginnen und Kollegen begegnet?Martin Schwarzbeck:
[14:27] Ja, sehr gern. Ich bin auch auf das Thema so richtig erst gekommen, weil ich diese Nachrichten gesehen habe. Uns schreibt so einmal am Tag im Schnitt eine Person, dass sie gerne, sie hat da einen ganz tollen Text und sie kann auch super schreiben und das ist sehr seriös und sie möchte den gerne auf netzpolitik.org veröffentlichen und was sie uns denn dafür zahlen müsste. Das sind meistens so Geschichten, die kommen so ein bisschen aus shady Businesses. Also sehr interessant fand ich zum Beispiel die Vaginalgewichtheberin, die gleichzeitig Sexcoach ist, die uns angeboten wurde. Oder Online-Casinos und Sportwetten, Erotik-Model-Agenturen, so CBD-Shops, Kryptohandelsplattformen...Patrick Lohmeier:
[15:11] Das ist alles schon so dezidiert shady.Martin Schwarzbeck:
[15:14] Bisschen anrüchig, ja. Ich erkläre mir das so, dass halt gerade die eben, weil viele sich schwer tun damit, ihre Anzeigen zu veröffentlichen, [sich bei uns melden]. Also es gibt ja so die seriöse Presse, die hat ja da immer noch Grenzen. Ich habe zum Beispiel von einem Medium gehört, die nehmen keine Cannabis-Anbauvereine und auch keine in Deutschland nicht zugelassenen Wettbuden. Und die fangen dann halt an, random Seiten anzuschreiben, die eine gewisse Reichweite haben, ob sie da nicht ihr Zeug veröffentlichen können. Die haben sich ja offensichtlich unsere Seite nicht angeguckt, weil auf Netzpolitik.org gibt es keine Werbung, erst recht kein Native Advertising. Aber wenn man sich dann mal anguckt, was auf den großen Nachrichtenseiten so an Native Advertising läuft, dann sieht man, das sind auch total normale, seriöse Geschäfte, die da in Form von Journalismus werben. Die großen Nachrichtenportale haben meistens selbst solche Agenturen. Da muss man dann gar nicht mehr hingehen und sagen "Hier, ich biete euch einen Text an über dies und das, was müssen wir zahlen, dass der veröffentlicht wird?", sondern mit denen muss man nur noch hinkommen "Wir wollen für dies und das werben" und die schreiben den Text selbst. Und das macht also nicht die normale Redaktion, sondern so eine Art Schattenredaktion, die dann diese Werbungen schreibt, die dann den ganzen Tag lang nur so... Schmuddelkram schreiben da.Patrick Lohmeier:
[16:43] Wie erkenne ich denn solche redaktionellen Texte? Ich denke jetzt an irgendwelche Social Media Influencerinnen, die eben werbliche Beiträge haben, wo dann einfach die ganze Zeit so ein Hashtag eingeblendet wird oder eine entsprechende andere visuelle Markierung, die das auch als Werbung kennzeichnet. Bei so einem Artikel denke ich mir, wenn da irgendwo oben rechts, oben links "Anzeige" steht oder "werblicher Inhalt", dann scrolle ich das doch weg.Martin Schwarzbeck:
[17:04] Ja, da gibt es sogar Studien zu mit Eye-Tracking. Menschen nehmen das wahr, sehen, dass da "Anzeige" steht, und wenn man sie nachher fragt, ob es eine Anzeige war, dann können die sich nicht mehr daran erinnern. Oft steht auch nicht mal "Anzeige" da, sondern so "in Kooperation mit", "Verlagsangebot" oder "sponsored by". Man muss dann schon wirklich sehr gewieft durchdacht haben, so was könnte das sein. Woran man es aber sehr gut erkennen kann, ob das jetzt Werbung oder redaktioneller Content ist: Wenn es um ein Produkt geht und da steht nicht direkt drüber, das es um irgendwas Kritisches geht. Beispiel: Man hat gerade entdeckt, dass Blei drin ist und ruft deshalb alle Produkte zurück. Also selbst wenn da neutral über ein Produkt berichtet wird in der Überschrift, kann man davon ausgehen, dass das eine Werbung ist. Auch, wenn es um ganze Produktklassen geht - der große Staubsaugertest -, kann man davon ausgehen, dass da Werbung drin steht. Tatsächlich, ja.Patrick Lohmeier:
[18:02] In welchen Medien? Sicher nicht bei Stiftung Warentest oder sagen wir mal bei etablierten Nachrichtenmedien.Martin Schwarzbeck:
[18:08] Sicherlich nicht bei Stiftung Warentest, aber durchaus bei etablierten Nachrichtenmedien. Das geht dann über das Affiliate-Konzept. Das ist so sehr ähnlich zu Native Advertising, nochmal ein bisschen anders. Das funktioniert so, dass die Geld dafür kriegen, wenn über diese Werbung, die bei ihnen steht, ein Produkt verkauft wird oder wenn über diese Werbung, die bei ihnen steht, ein Mensch auf ihrer Seite landet. Das sind dann oft diese Tests und da steht dann auch drüber "Wir haben hier Affiliate-Links und verdienen daran mit, aber natürlich hat das keinerlei Auswirkungen auf unsere Auswahl." Aber man kann ja davon ausgehen, dass der Anreiz, das Produkt, an dem man mitverdient, auf Platz 1 eines Tests zu setzen, einfach immens ist.Patrick Lohmeier:
[18:55] Rechtlich problematisch wird es für meine Kollegin Susanne Punsmann vom Faktencheck Gesundheitswerbung aber zum Beispiel dann, wenn sie in ihrer Arbeit auf vermeintlich unabhängige Produkttests stößt, die Unwahrheiten verbreiten und damit ein akutes Risiko für Kundinnen und Kunden dazustellen. Dazu hat mir Susanne ordentlich was gehustet. Oder in diesem Fall geschnieft.
Dr. Susanne Punsmann:
[19:17] Ja, da wird das beste Nasenspray beworben, wird getestet und dann hat man gleich den Affiliate-Link und landet bei Amazon. Man kann es dann auch etwas weiter unten bei Ebay und anderen Anbietern bekommen. Aber das ist schon immer mit einem Link hinterlegt. Und auch da sind die Werbeaussagen zum einen, da tue ich mich mit diesen Kriterien sehr schwer, die die aussuchen, um zu einem Testsieger zu kommen. Zum anderen sind diese Tests auch nicht immer ganz richtig. Also gerade zum Thema Nasenspray, wo ich das hier gerade erwähne, hatten wir auch mal einen Test darauf hingewiesen, dass das falsch ist. Weil da stand: macht nicht süchtig. Und es war so, dass es ein Nasenspray war. Da ist man dann mit dem Affiliate-Link über diesen Vergleichstest direkt bei Amazon gelandet. Und da konnte man, ich weiß nicht wie viele Packungen davon bestellen, aber man konnte das monatelang nehmen. Und es war ein Präparat, wo in dem Beipackzettel stand, dass es nicht länger als eine Woche ohne ärztliche Konsultation eingenommen werden soll.Dr. Susanne Punsmann:
[20:24] Da muss man einfach vorsichtig sein. Das sind keine offiziellen Tests. Es geht aber noch viel, viel schlimmer. Und zwar haben wir mittlerweile auch ganz, ganz viel vermeintlich journalistische Angebote im Netz. Also ich sage mal, alles, was sich so ein bisschen anhört wie Apotheken Umschau. "Spiegel der Gesundheit" fällt mir gerade so ein, das ploppt auf, sieht nach einem redaktionellen Beitrag aus. Dort wird dann auch ganz lange über eine Erkrankung gesprochen. Manchmal werden auch Tests gemacht und bei diesen Tests ist dann immer ganz auffällig, da werden dann fünf Präparate getestet, im Regelfall Nahrungsergänzungsmittel.Und der Testsieger ist sehr, sehr ausführlich beschrieben, hat nur Vorteile und der einzige Nachteil, den er hat, ist manchmal, dass er schwer erhältlich ist oder mangelnde Verfügbarkeit. Aber wenn man Glück hat, kann man ihn über diese Seite noch bestellen und die dann unter ferner Liefen waren, die haben dann ein paar Vorteile, aber auch ein paar gravierende Nachteile. Ja, während bei dem Testsieger, den ich dann bestellen soll, wird über diesen vermeintlich redaktionellen Beitrag lediglich suggeriert, das einzig Negative sei, dass ich den vielleicht nicht mehr bekomme, wenn ich denn jetzt nicht sofort bestelle. Manchmal noch gekoppelt mit einem Gewinnspiel und, und, und. Und ja, klar, und da wird dann bestellt und was suggeriert, was nicht zutrifft. Und das Gefährliche daran ist, dass diese vermeintlich redaktionellen Beiträge so in den ersten zwei, drei Sätzen, ich sag mal, wissenschaftlich völlig okay sind. Und wenn man merkt, man liest einen Text, bei dem der anfangs stimmt, weil man das schon irgendwo gehört hat, irgendwo weiß, dann ist man auch eher geneigt, das zu glauben, was dann in den folgenden Beiträgen kommt. Und das ist halt gefährlich.
Patrick Lohmeier:
[22:01] Auf ach-so seriös klingende Portale wie "Spiegel der Gesundheit", was Susanne gerade zitierte und dergleichen, werden wir später noch zu sprechen kommen. Aber jetzt will ich erst einmal von Martin Schwarzbeck wissen, wie viel Kohle steckt denn hinter diesem Geschäft mit den Advertorials? Also wo ist der finanzielle Anreiz und vor allem wie groß dafür, dass eben Medientreibende Verbraucherinnen und Verbraucher mit diesen redaktionellen Beiträgen, die aber eigentlich nur sehr, sehr lange Werbetexte sind, hinters Licht führen?Martin Schwarzbeck:
[22:45] Ich habe angefangen, dass ich mir den Spaß gemacht habe, die Leute, die uns anschrieben, zu fragen, was sie denn dafür zahlen wollen. Die meisten wollten dann erstmal verhandeln, aber ich wollte einfach eine Zahl wissen, die die mir so nennen. Und da kam dann das Höchste, was einer geboten hat, war 850 Euro. Und einer bot 20 Euro. Da war ich dann schon so ein bisschen beleidigt. Aber es lässt sich natürlich auch richtig viel Geld damit verdienen. Also ich habe mal gecheckt. Eine "Product Story", so nennt sich das Native Advertising bei Bild.de und Welt.de. Also bei Bild.de kostet so eine Product Story, wenn 30.000 Leute die angucken, 80.000 Euro, fast 80.000 Euro. Bei Welt.de sind es für 23.000 Leute 70.000 Euro. Das sind richtige Hausnummern. Und da das ja alle machen, summiert sich das zu einem gigantischen Markt. Ich habe versucht, ein paar Studien dazu zu finden, wie groß der ist.Es war relativ schwierig. Ich habe eine gefunden von 2019, die sagte, für dieses Jahr einen Umsatz von 21 Milliarden Dollar in Deutschland, in Europa voraus. Ne, in Deutschland tatsächlich. 21 Milliarden Euro nur für Deutschland. Also das ist ein Riesending und es wird noch viel größer. Also man kann man ja annehmen, dass die Grenze immer weiter aufgeweicht wird, auch zwischen Journalismus und Anzeigenabteilung. Wenn da so viel Geld dahinter steckt, das da reindrängt. Letzten Endes muss man ja sehen, das läuft alles immer noch auf dem Hintergrund der Medienkrise ab. Also Print stirbt weiterhin und online versucht man weiterhin mehr oder weniger verzweifelt, da ausreichende Einkommensquellen zu finden. So ganz viele setzen ja jetzt auf diese Paywall-Modelle, entweder man zahlt mit Geld oder man zahlt mit seinen Daten. Paywall ist jetzt plötzlich wieder ein großes Thema, aber so richtig scheint das alles noch nicht zu funktionieren, weil man sieht es ja daran, dass sie es eben dann nötig haben, solche fragwürdigen Werbeformen wie Native Advertising anzubieten.
Patrick Lohmeier:
[25:03] Auf meine Frage nach den möglichen rechtlichen Folgen für Schleichwerbung, Also beispielsweise Strafen für nicht ausreichend als Werbung gekennzeichnete Berichterstattung auf einer Nachrichtenseite, konnte mir Martin Schwarzbeck keine wirklich befriedigende Antwort geben. Und nicht deswegen, weil es keine Mittel und Wege gäbe, solche Inhalte zu melden oder sich dagegen juristisch zu Wert zu setzen. Sondern einfach, weil diese Mittel und Wege oft keine weitreichenden Konsequenzen haben. So kann der Deutsche Presserat zwar ein Medium für unsachliche Berichterstattung öffentlich rügen, aber eben keine Geldstrafen verhängen. Und privat oder von Verbraucherschutzorganisationen angestrengte Klagen gegen fehlerhafte oder werbliche Berichterstattung gehen im Erfolgsfall zwar mit Geldstrafen für die Verursacher einher, die angesichts der Millionengewinne, die mit Advertorials erwirtschaftet werden, aber zumindest von reichweitenstarken Medien aus der, naja, sprichwörtlichen Portokasse bezahlt werden können.Patrick Lohmeier:
[26:10] Im Laufe des Gesprächs über nur scheinbar aussagekräftige Testberichte oder Artikel über Produktneuheiten kamen Martin Schwarzbeck und ich auch auf diese Kacheln unter den redaktionellen Beiträgen zu sprechen. Sie kennen diese effekthascherischen Bilder mit ebenso effekthascherischen Überschriften sicher, denn die sind ja nicht nur bei Bild.de und Spiegel Online und Fokus Online und vergleichbaren Nachrichtenseiten zu finden, sondern quasi überall im Netz, wo es Geld zu verdienen gibt. Beispielsweise bei chip.de oder tvspielfilm.de, die wie die gerade genannten Nachrichtenwebseiten ebenfalls zu den Top 10 reichweitenstärksten Online-News-Medien in Deutschland gehören.Patrick Lohmeier:
[26:55] Inhaltlich haben die vielleicht wenig mit thematisch breit aufgestellten Nachrichtenseiten zu tun. Die ganzen, naja, Leseempfehlungen, oft unter Überschriften wie "Das könnte sie auch interessieren" oder "Weitere Meldungen", sind aber oft die gleichen. Und die sehen zwar auf den ersten Blick aus wie redaktionelle Beiträge und sind kaum erkennbar als Anzeigen markiert. Hinter den Links zur, ich zitiere hier mal, "Wärmepumpe, die die Experten verblüfft" oder auch "Endlich ein Elektroauto, das sich alle leisten können" und dem, was ist das, ein aktueller Testbericht einer Seite namens "Apotheke Aktuell" zu einem Nagelpilzlaser, stehen aber in aller Regel kostspielige und unseriöse Angebote.Ach, wissen Sie was? Ich lasse mal - Was steht hier noch? - den "25 Kilo in drei Wochen Fettweg-Tee" beiseite und das einzig wirksame Mittel gegen Haarausfall auch links liegen und klicke auf diesen Nagelpilzlaser. Und plötzlich heißt das Medizinportal nicht mehr "Apotheke Aktuell", sondern "Regionalapotheke". Wobei eigentlich auch nicht wirklich, denn die URL ist die des Herstellers des verblüffenden Geräts und weder Apotheke dies noch Apotheke das. Überraschenderweise ist der Laser gemäß dem Testbericht auf der Anbieterseite natürlich ein wahres Wundergerät. Und was eben noch auf t-online.de als Testbericht verlinkt war, ist nun ein Kommentar. Vergleichbare Geräte von Mitbewerbern können weniger und kosten mehr, verrät uns der Autor. Und einziger Nachteil des Laser-Wunder-Gadgets gegen Nagelpilz: Es ist nicht bei Amazon und Ebay erhältlich und muss direkt beim Anbieter bestellt werden.
Patrick Lohmeier:
[28:40] Und so ein glücklicher Zufall, dafür muss man nicht mal die Webseite wechseln, denn wir sind ja bereits da. Und einen Klick weiter sind wir schon beim Bestellen-Button. Nebst Hinweis, dass es gerade eine unschlagbare Rabattaktion gäbe und nur noch acht Exemplare auf Lager seien. Wegen, Zitat, der "positiven Berichterstattung in den Medien und der hohen Nachfrage aufgrund der Rabattaktion". Und dann auch noch dieses tolle Testziegel vom Deutschen Konsumentenverein[sic!] mit Note Sehr gut. Gibt's die überhaupt? Ach, komm, egal. mal fünf Zehen gerade sein lassen und lieber nochmal lesen, was Podologe Dr. Jonas Mühlberger zu sagen hat. Der empfiehlt nämlich den Nagelpilzlaser auch. Naja, online ist gemäß meiner Recherchen der junge Arzt mit einem umwerfenden Lächeln sonst nirgendwo zu finden. Und da gibt es ja auch noch die tollen Nutzerbewertungen. Leider nur als Grafiken und ohne Hinweis darauf, woher sie stammen. Na gut, die Hoffnung stirbt zuletzt. Gilt übrigens auch für Widerrufe und Retouren, die der Anbieter laut seiner allgemeinen Geschäftsbedingungen gemäß geltendem deutschen Recht zwar anbietet, aber mit dem Hinweis darauf: Achtung, das könne gegebenenfalls teuer werden, weil Kundinnen und Kunden die Rücksendekosten selber tragen müssten und der Versand von außerhalb der EU erfolge.Oh je! Nichts zu danken. Ich mache das hier, damit Sie es nicht tun müssen. Aber nun ist's auch genug. Den Klick aufs Goldmünzen-Abo zur finanziellen Absicherung fürs Alter oder - Was gibt's hier noch? - den Trick, mit dem ich an ein Eigenheim für unter 100.000 Euro komme, den spare ich mir mal. Klingt doch alles reichlich unglaubwürdig und unseriös, oder? Aber in solchen Fällen greifen die Werbetreibenden mit ihren News-Kacheln auch gerne mal auf die Marketing-Allzweckwaffe zurück, mit der wir uns bereits in Folge 1 auseinandergesetzt haben: Prominente. Und bis die sich rechtlich zur Wehr setzen, sind sie dabei, ob sie wollen oder nicht.
[...] Erstmal die, die ein sehr positives Gefühl vermitteln, weil es eben sehr junge, attraktive Menschen sind, die dafür etwas werben, meist mit strahlenden Gesichtern. Oder es sind eben Prominente, die in die Kamera strahlen. Vielleicht auch manchmal einfach KI-generierte Persönlichkeiten, die so ähnlich aussehen wie eben die echten Prominenten, ohne dass man deren Namen nennt. So von wegen "Dieser TV-Star empfiehlt ihnen folgendes, dieses und jenes." Und die andere Art von Bildern sind vor allem die, die einen so irritieren, dass man einfach wissen will, was dahinter steckt. Also oft sehe ich eben auch so Schlagzeilen wie "Mit diesem Mittel werden sie nie wieder Völlegefühl haben!" Und dann eben ein Bild von einem merkwürdigen Pilz.
Martin Schwarzbeck:
[31:12] Ja, das gibt es sicherlich. Und wir gucken hier jetzt beim Gespräch die ganze Zeit auf einen Darm.Patrick Lohmeier:
[31:17] Ja, das triggert ja natürlich auch irgendwas. Aber nichts Positives, sondern eher so Irritation. So "Was ist das denn? Das sieht ja merkwürdig aus. Das klicke ich mal an." Auch hier wird tatsächlich ein BH beworben mit einer Frau, die sich offenbar gerade selbigen aussieht. Wo man wahrscheinlich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht das bekommt, wenn man draufklickt, was sich jetzt einige Menschen - vor allem überwiegend Männer wahrscheinlich - erhoffen, wenn sie da drauf klicken.Martin Schwarzbeck:
[31:44] Und darunter haben wir dann hier das Medfluencer-Thema. Dr. Krüger, Orthopäde, klärt uns auf über Barfußschuhe. Da steht auch wieder in Frage, wie neutral Dr. Krügers Meinung in diesem als Anzeige kennzeichneten Beitrag ist. Also in dieser Durchsetzung, in dieser Mischung ist es ganz schwer, auf den ersten Blick auseinanderzuhalten, was jetzt Werbung, was jetzt Anzeige ist.Patrick Lohmeier:
[32:10] Hier ein Beitrag von viralreporter.net. Das ist ja irgendwie nur ein ganz klein bisschen weg von netzpolitik.org.Martin Schwarzbeck:
[32:20] Ja, also genau. Man schneidet das erstmal nicht mit, dass das nicht sehr seriös ist. Und wir haben ja jetzt immerhin zuerst mal auf einen Artikel geklickt und dann geschaut, was drunter ist. Dasselbe läuft auch auf den Startseiten ab. Also man kann genauso quasi ins Wohnzimmer von Focus Online gucken und wenn man da weit genug runterscroll dann findet man genau den selben Kram. Da fängt es schon an wahrscheinlich. Werbung, Werbung, Werbung. Das ist immer so als Service getarnt. "So kündigen sie wie ungewollte Verträge" und am Ende ist es doch wieder Werbung. Werbung, Werbung, Werbung, Werbung ...Patrick Lohmeier:
[32:57] So vielfältig die virtuellen Anbieter und Persönlichkeiten auch sind, die uns in den sozialen Netzwerken und sonst wo im Internet etwas verkaufen wollen und die ich in den letzten Wochen kennenlernen durfte, so ähnlich sind sie sich in einem zentralen Grund dafür, warum wir auf sie hereinfallen. Und zwar immer wieder. Wir möchten ihnen vertrauen. Weil sie prominent und erfolgreich sind. Weil sie guten Journalismus bieten. Weil wir mit ihrer Marke und ihren Produkten aufgewachsen sind. Weil sie das Leben leben, nachdem wir uns sehnen. Oder weil sie, ich zitiere mal das Insta-Profil einer gewissen Zara Secret, unsere "digitale beste Freundin" ist. Und ich möchte nicht behaupten, dass Vertrauen in solch eine digitale Lichtgestalt oder ihr Angebot etwas kategorisch Schlechtes ist. Aber wie heißt es so schön schon seit langer Zeit vor Erfindung des Internets? Wenn es ums Geld geht, hört der Spaß auf. Was aber eben nicht aufhört, ist mein Interesse daran, welche Werbung wirkt und warum und Wissenschaft, um ein weiteres W-Wort zu nennen. Und etwas, in das ich großes Vertrauen habe, dass es uns zu schlauren und gut geschützten Verbraucherinnen und Verbrauchern macht.Prof. Dr. Kristina Klein:
[34:15] Ja, also ich bin Professorin für Marketing und Konsumentenverhalten. Das heißt also, was treibt Konsumierende, was beeinflusst sie. Was habe ich alles gelernt? Was beeinflusst das meine Entscheidung? Wenn man sich immer selber so ein bisschen reflektiert, wie viele Dinge kauft man eigentlich, die schon die Eltern gekauft haben? Aber gleichzeitig dann eben auch, was sind denn die externen Determinanten von Konsumentenverhalten? Das heißt, ganz großes Thema, natürlich auch im Kontext von Influencer-Marketing, sozialer Einfluss. Also wir können uns ja nicht davon freimachen, wie andere über uns denken und wie auch andere über uns denken im Sinne von, was wir kaufen, welche Dinge wir tragen, welche Autos wir fahren, welche Berufsentscheidungen wir treffen, weil wir immer natürlich auch im Blick haben, wie andere über uns denken und je nachdem auch Freunde oder Familie. Da sind mal mehr, mal weniger wichtige Personen dabei und was das für einen Einfluss aufs eigene Konsumverhalten auch haben kann. Und was bedeutet das dann auch für uns?Patrick Lohmeier:
[35:23] Das ist Professor Dr. Kristina Klein von der Universität Bremen. Und wenn jemand weiß, wie Online-Marketing funktioniert, dann wohl sie.Prof. Dr. Kristina Klein:
[35:31] Was macht Technologie zum Beispiel mit Marken? Wie müssen Marken sich vielleicht anders aufstellen im Kontext von technologischer Disruption? Und ein anderer Kollege beschäftigt sich im Kontext digitales Marketing, was Technologie kann, wie sich das verändert. Und ich eben damit, wie Technologie auch Konsumverhalten verändert.Patrick Lohmeier:
[35:53] Was sind denn gemäß Ihrer Erfahrung, Ihrer Forschung der letzten Jahre die digitalen Hotspots, nenne ich es mal, für Influencer-Marketing? Also wo gehen die Unternehmen, die kommerziellen Anbieter hin, um ihre Produkte zu verkaufen?Prof. Dr. Kristina Klein:
[36:06] Ja, es gibt ja sozusagen die gerade besonders attraktiven Plattformen, das sind Instagram und TikTok. Facebook ist tatsächlich was, sagen alle immer scherzhaft, das ist für die alten Leute. Das heißt, jedes Unternehmen hat ja in seinen Entscheidungen immer die eigene Zielgruppe im Blick. Das heißt, wenn meine Zielgruppe tatsächlich eher unter 30 ist oder unter 35, die findet man eben nicht mehr auf Facebook, sondern die findet man dann auf Instagram oder TikTok. Dieses ganze Thema Influencer-Marketing ist ja im Prinzip nichts Neues. Man hat ja immer schon, auch in der Welt, wo es noch keine digitalen Medien gab, hat man sogenannte Wortführer gehabt. Also hat immer bestimmte Expertinnen und Experten für bestimmte Themen gehabt. Man hat sich Testimonials geholt, ob man jetzt über Dr. Best redet oder generell Leute, die einen weißen Kittel anhaben, die dann für uns die Anmutung haben, dass sie tatsächlich auch Ärzte sind. Müssen sie ja nicht unbedingt sein. Können auch einfach Schauspieler mit weißen Kitteln sein, aber der weiße Kittel ist eben das Symbol dafür.[CLIP]
Prof. Dr. Kristina Klein:
[37:24] Sie haben Werbung mit Prominenten, die es auch immer schon gegeben hat. Also es gibt Mikro-Influencer, die haben wenig Follower. Dann gibt es sozusagen Midsize-Influencer, und dann gibt es eben Mega-Influencer, die auch vielleicht gleichzeitig gegebenenfalls sogar Prominenz außerhalb der digitalen Medien erreicht. Stars, Fußballer und so weiter.Prof. Dr. Kristina Klein:
[37:50] Und bei den ganz Großen, da läuft das natürlich dann über das entsprechende Management, über das Unternehmen an die herangehen und das ist auch extrem teuer, mit denen zu kooperieren. Und dann weiß man aus der Forschung und auch eben nicht nur aus der Forschung in digitalen sozialen Medien, sondern eben auch aus, sagen wir mal, der alten traditionellen Welt, Fernsehen oder Kinowerbung, dass es für Menschen seltsam ist, wenn man das Produkt quasi platt in die Kamera hält. Also weil man da tatsächlich direkt dieses Gefühl hat "Ja, okay, da will mir jemand was aufs Auge drücken." Das ist nicht authentisch. Da kann ich sozusagen diese Verkaufsabsicht sofort identifizieren. Und wir haben ja im Prinzip als Menschen die Intention, dass wir uns nicht so gerne was aufzwingen lassen wollen. Also wir wollen die Freiheit haben, uns für irgendwas zu entscheiden. Und das ist ja auch das, wo sozusagen Unternehmen und Verbraucherschutzorganisationen so ein bisschen Friktion haben. Die einen sagen, es muss ganz klar erkennbar sein, dass das irgendwie mit kommerzieller Absicht passiert und das Unternehmen sagt, naja, aber wir wissen, wenn das sehr stark kommerziell wahrgenommen wird, dann kaufen die Leute das nicht so gerne oder wollen sich dann davon nicht so gerne überzeugen lassen. Am besten funktioniert das in Anführungsstrichen, wenn diese Verkaufsabsicht möglichst natürlich rüberkommt.Patrick Lohmeier:
[39:14] Also alles nur alter Wein in neuen Schläuchen? Will heißen: Im Grunde haben sich nur die Influencer bzw. Promis bzw. Leitfiguren gewandelt, aber Werbebotschaften und Produkte gar nicht mal so? Und was eben früher Dr. Best und Frau Antje aus Holland waren, sind heute Medfluencer mit dem Stethoskop um den Hals und die coole Journalistin mit ihren Crackern im Müsli?[CLIP]
Patrick Lohmeier:
[39:47] Nein, so einfach ist das natürlich alles nicht. Und mit solchen billigen rhetorischen Fragen kann ich Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, selbstverständlich nicht täuschen. Genauso wenig wie die abgezockte Influencerin, die gelangweilt eine Tube Zahnpasta oder eine Packung Buntstifte in die Kamera hält. Aber eine Frage, die uns tatsächlich in der nächsten Folge beschäftigt, ist die, was hat Bond, äh, James Bond, mit all dem zu tun? Einfache Antworten, warum wir den digitalen Werbeversprechen immer wieder verfallen, hat auch Professorin Christina Klein nicht. Aber sie kann mir und uns zumindest sehr gut erklären, welche Neuronen bei welchen Marketingbotschaften durch unsere Köpfe feuern. Außerdem gibt es nächstes Mal guten Rat oder vielleicht vielmehr Trost für alle, die angesichts all der Fakes und falschen Versprechen in der Online-Werbung zu verzweifeln beginnen.[CLIP]
All dies und mehr im nächsten und letzten Teil unserer Podcast-Reihe. Und als Happy End zum Thema der heutigen Episode über Native Advertising und Newsfluencer schon mal ein wirklich stabiler Tipp von Martin Schwarzbeck von Netzpolitik.org, wie sie, zumindest in neun von zehn Fällen, werbliches Blabla von echtem Qualitäts-Onlinejournalismus unterscheiden können.
Martin Schwarzbeck:
[41:16] Wenn es um Produkte geht, kann man immer super skeptisch sein, weil ein richtiger Journalist, der würde nicht einfach über ein Produkt schreiben und der würde erst recht nicht gut über ein Produkt schreiben. Der hätte sofort Sorge, dass das zu werblich klingt. Sowas gibt es eigentlich nicht im Journalismus. Wenn man da über ein Produkt schreibt, dann deshalb, weil das Produkt gerade irgendwas verkackt hat oder eine Lebensgefahr darstellt oder so. Dieser Werbejournalismus, der ist immer sehr positiv. Und der richtige Journalismus ist eigentlich immer sehr negativ. Wir schreiben über Probleme für gewöhnlich. Und deshalb lässt sich das eigentlich ziemlich einfach auseinanderhalten.Patrick Lohmeier:
[42:01] Dürfen die das ist ein Podcast der Verbraucherzentrale Berlin, gefördert durch das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, und wird moderiert und produziert von mir, Patrick Lohmeier. Ich bedanke mich herzlich bei allen Menschen, die die Entstehung dieses Formats ermöglichen und mit ihrer Expertise unterstützen. Sollten Sie Fragen, Kritik oder Themenwünsche haben, schreiben Sie mir gerne an podcast@vz-bln.de. Diese und weitere Kontaktmöglichkeiten und Informationen finden Sie natürlich auch im Begleittext zu dieser Episode. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bei Fragen, Kommentaren und Themenwünschen rund um den Podcast erreichen Sie Patrick Lohmeier per E-Mail an podcast@vz-bln.de.