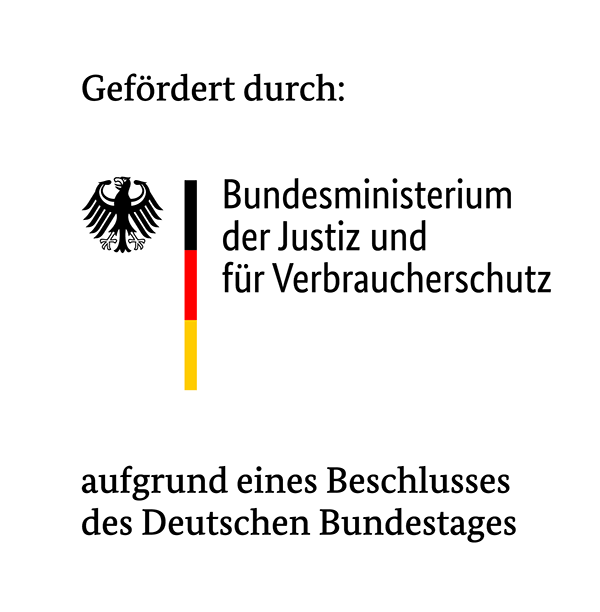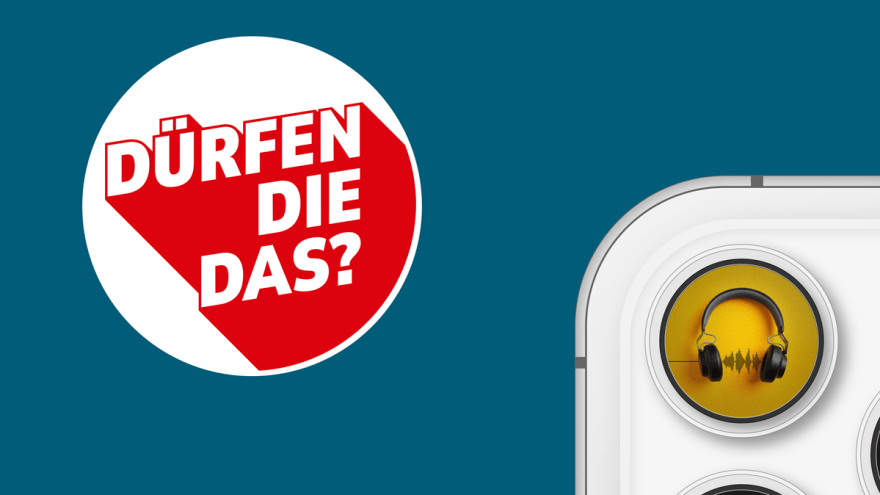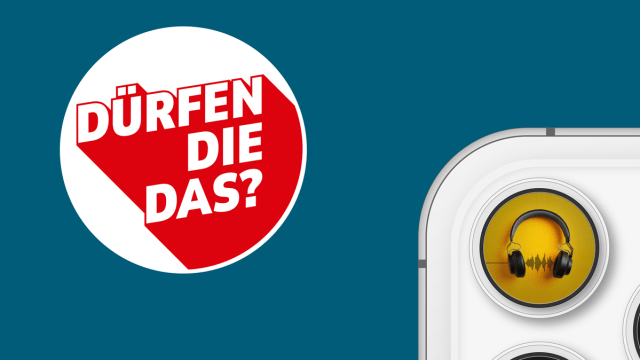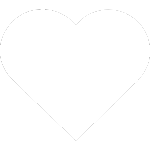Die wissenschaftlich erforschte Chemie hinter dem Zaubertrank 'Influencer-Werbung' und wie wir von diesem möglichst wenig naschen
In der letzten Folge unserer sechsteiligen Reihe rund um Online-Werbung wechseln wir die Seiten und beleuchten die Gründe dafür, warum Unternehmen mehr und mehr auf Influencer statt klassischer Werbeträger:innen und -mittel setzen. Müssen wir in den nächsten Jahren mit einer Schwemme an KI-Persönlichkeiten rechnen, die uns etwas verkaufen wollen? Und welche Hebel müssen bewegt werden, damit unsere Verbraucherrechte dabei gewahrt bleiben?
Diesmal mit den Expertinnen Prof. Dr. Kristina Klein (Universität Bremen), Angela Clausen (Verbraucherzentrale NRW), Luise Molling (foodwatch e.V) und Dr. Britta Schautz (Verbraucherzentrale Berlin). Moderation & Produktion: Patrick Lohmeier (Verbraucherzentrale Berlin).
dürfen die das? wird gefördert durch das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestags.
Wir freuen uns über Lob, Kritik und Themenwünsche per E-Mail an podcast@vz-bln.de. Weitere Informationen zum Podcast und alle Episoden finden Sie unter verbraucherzentrale.de/dddpodcast.
Quellen:
- netzpolitik.org Homepage
- Homepage des markstones Institute of Marketing, Branding and Technology an der Universität Bremen (uni-bremen.de)
- foodwatch.org Homepage
- Faktencheck Gesundheitswerbung (Gesundheitlicher Verbraucherschutz im digitalen Health-Style-Markt) auf Verbraucherzentrale.de
- Alternativmedizin: Wikipedia-Eintrag zu rechtlichem Rahmen des Begriffs (Wikipedia DE)
- Foodwatch-Analyse: Influencer werben mit unerlaubten Gesundheitsversprechen (tagesschau.de, 20. Juni 2025)
- DAK-Suchtstudie: Millionen Kinder haben Probleme durch Medienkonsum (dak.de, 12. März 2025)
- Studie: Trotz Fake-News vertrauen junge Deutsche Social Media am meisten (presseportal.de, 11. Juni 2025)
- Digital 2025: Wie Deutschland Social Media nutzt - und was das für Brands bedeutet (wearesocial.com, 27. Februar 2025)
- Deutsche Jugendliche verbringen besonders viel Zeit am Bildschirm (zeit.de, 15. Mai 2025)
- @marktcheck: "Die Wahrheit hinter Influencer-Produkten von Knossi & Co." (YouTube, 7. November 2024)
- @ZDFheute: "Urteil zu Influencer-Postings: Cathy Hummels über ihren Erfolg vor dem BGH" (YouTube, 9. September 2021)
- @kaufland: "GÖNRGY und @montanablack bringen drei neue Sorten auf den Markt" (YouTube, 20. Februar 2025)
- @zara_secret: "Statement und Erklärung zu den Energy Pearls" (Instagram, 20. Juli 2024)
- @lilmiquela: Monitor-Werbung (Instagram, 20. Mai 2024)
- @TheMorpheusVlogs: Wie Scam Produkte jetzt KI-Fake Werbung nutzen YouTube, 11. Juni 2025)
- @nathaliegleitman: "Ist ein Blähbauch normal?" #Werbung (Instagram, 10. Januar 2025)
- @lamiyaslimani: "Ich kenne das Problem mit den Naturlocken ..." #Werbung (Instagram, 21. Mai 2022)
- @elanhelo: "Eigenes Produkt" #Werbung (TikTok, 13. Mai 2023)
- @ViktoriaSarina: "KINDER Schokolade Torte OHNE BACKEN 10 000 Kalorien" (YouTube, 27. Dezember 2018)
Ganze Folge zum Nachlesen
- Hier klicken, um das Transkript zu öffnen...
Patrick Lohmeier:
[0:02] Es tut mir leid, ich wollte Sie mit dem unbefriedigenden Ende der letzten Episode wirklich nicht ärgern. Denn ich selbst liebe ja auch große Kinoabenteuer und ganz besonders actionreiche Agentenfilme. Und deswegen, Frau Prof. Dr. Kristina Klein, bitte verraten Sie es uns. Wie war das denn nun mit den schicken Autos bei James Bond 007?Kristina Klein:
[0:23] Am besten funktioniert das in Anführungsstrichen, wenn diese Verkaufsabsicht möglichst natürlich rüberkommt. So wie auch bei Produktplatzierungen bei Kinofilmen. Wenn Sie sich die alten James-Bond-Filme angucken, da trinkt er halt da mal ein Bier und hier mal fährt er dann den BMW, aber es ist jetzt nicht so, dass dann halt oder den Audi, dass das dann sozusagen zehn Sekunden lang das Audi-Logio zu sehen ist, sondern ab und an und man weiß halt, dass er einen fährt, aber es ergibt sich natürlich durch die Handlung im Kinofilm. Und so muss das eben auch bei jedweder Werbung sein und insbesondere eben auch bei Influencern. Und damit das eben auch glaubwürdig ist, dass man dieses Produkt im natürlichen Lebensraum, sozusagen in der eigenen Lebenswirklichkeit auch nützlich findet und nutzt und davon überzeugt ist. Und nur dann entsteht bei Konsumentinnen und Konsumenten eben auch das Gefühl, das ist was, was ich auch gebrauchen könnte. Und damit steigt eben auch die Intention, das gegebenenfalls dann auch zu erwerben.Patrick Lohmeier:
[1:28] Noch ein unvollendeter Gedanke, mit dem ich Sie und mich, denn ganz ehrlich, ich kann mich auch ganz gut selber auf die Folter spannen, aus der letzten Folge herausgeschickt habe, war die Frage, ob das, was uns heutzutage als Werbung in Online-Medien begegnet, vor allem in Social Media, im Grunde ziemlich genau das Gleiche ist, was eben früher am Kiosk, im Fernsehen oder Radio anzutreffen war. Nur eben im neuen digitalen Gewand. Und nach den zahlreichen Gesprächen der letzten Wochen kann ich darauf mit einem klaren Jein antworten. Denn die Produkte, ob fettige Fritten oder vitaminreiche Vitalmacher, vermeintlich sichere Geldanlagen, esoterischer Unfug und Glücksspiele im Tausch gegen Kundendaten, das ist ja alles nicht neu. Aber anders als damals müssen wir dank individuell, weil datenbasiert auf uns zugeschnittener Marketingbotschaften und menschlichen Werbeträgern, die wir uns in aller Regel selber aussuchen, noch genauer hingucken, um Werbung überhaupt als Werbung zu erkennen. Es gibt einen Unterschied, ob da eben ein George Clooney steht, ob er eine Espresso-Werbung macht oder eben eine Influencerin, eine bekannte mir ein Beauty-Produkt verkauft.Kristina Klein:
[2:44] Ja, das ist so ein bisschen, da sprechen sie so ein bisschen ein. Es gibt so eine Art Influencer-Dreieck. Also wenn wir über Influencer sprechen, dann haben wir ja quasi den oder die Influencerin, dann haben wir die Marke und dann haben wir eben auch den Verbraucher oder die Verbraucherin.Kristina Klein:
[3:00] Und es muss bei allem so ein bisschen so eine Balance bestehen. Also das Produkt muss irgendwie auch zu dem Influencerin und zu dem Influencer passen, aber die Influencerin und der Influencer muss auch irgendwie eine Beziehung haben oder ähnlich sein wie ein Verbraucher oder es muss eben jemand sein, den der oder die Verbraucherin wirklich auch gut findet, also wo er eben sozusagen gerne hin möchte. Das nennen wir Wishful Identification. Also das ist das, was ich gerne, wo ich vielleicht anstrebe, möchte ich gerne berühmt sein wie George Clooney und durch die Kanäle von Venedig Schippern. Oder ist das jemand, dem ich ähnlich bin? Das nennen wir dann Similarity Identification. Also dass wir halt sagen, okay, das ist ja ganz oft bei Influencern und Influencern in dem Thema jetzt Kosmetikprodukt, das sind vielleicht Leute, die haben vielleicht ähnliche Hautprobleme wie ich oder so. Und die können halt dann tatsächlich glaubwürdig mir zusammen mit diesem Produkt irgendwie die Botschaft geben, ja mit dem Produkt, da kann man das kaschieren oder das macht die Pickel weniger und so weiter und so fort. Und das ist vielleicht einfacher, mit jemandem zu arbeiten, der sozusagen auf Augenhöhe mit Verbraucherinnen und Verbrauchern ist, während ich, wenn ich zum Beispiel eine Luxuskarosse bewerbe.Kristina Klein:
[4:16] Dann macht es vielleicht auch eher Sinn, einen Prominenten oder eine Prominente zu nehmen, wo das eben Teil des Lifestyles ist und wo ich dann gegebenenfalls auch hin will. Also das bietet sich dann gegebenenfalls mehr an. Es gibt ja mittlerweile tatsächlich auch Unternehmen, die gemeinsam mit Influencer, großen Influencern und Influencern eigene Produktlinien tatsächlich rausbringen, die auch extrem erfolgreich sind.[CLIP]
Kristina Klein:
[5:07] Ich glaube, das Stichwort ist und bleibt tatsächlich dieses Thema Authentizität und nicht nur irgendwie Authentizität in der Botschaft, die man vermittelt, sondern eben auch der Frage, wie viele Partnerschaften hat man, wie ausgewogen ist der Mix zwischen dem eigentlichen Kanal, den man noch hat und sozusagen der Werbung dahinter. Denn das weiß man auch aus traditionellen, sagen wir mal, als es digitale Medien so noch nicht gab, Werbemaßnahmen, dass man weiß, wenn Leute zu viel machen, dann wird es auch unglaubwürdig, Weil dann bin ich sozusagen die menschliche Werbeplattform. Ich mache alles, habe Sache, ich kriege das Geld dafür. Und das ist dann natürlich auch extrem unglaubwürdig. Und das ist dann für alle schlecht, für die Marken und auch für den Influencer an sich. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen das Geheimnis, dass man selektiv sozusagen auswählt, mit wem man arbeitet und es eben auch nicht übertreibt. Weil meine eigentliche Motivation, um einem Influencer zu folgen, ist der organische Inhalt. Also ich interessiere mich wirklich für das, was der zu erzählen hat.Kristina Klein:
[6:18] Sei es über Reisen, sei es über Fashion, sei es über das eigene Leben, Momfluencer und so weiter. Das interessiert mich. Und wenn ich aber das Gefühl habe, ich bekomme halt nur noch Werbung eingespielt, dann setzt natürlich auch so ein Reaktanzverhalten ein, dass man sagt, naja, dafür habe ich diesen Kanal jetzt nicht abonniert. Der oder diejenige möchte mir jetzt nur noch Dinge verkaufen.Patrick Lohmeier:
[6:40] Ich meine, gerade so bei Beauty- und Wellnessprodukten, da stapelt man ja jetzt nicht eben tief. Wenn man da erfolgreiche Influencerin ist, dann zeigt man eben auch in der Regel, so ist meine Wahrnehmung, was man hat. Noch dazu hat man eben Hunderttausende oder gar Millionen Follower. Schadet das nicht der Popularität, aber dieser vermeintlichen Authentizität, die man dann so als Personenmarke vermittelt? Weil da muss ja dann auch selbst den härtesten Fans irgendwann auffallen, Follower, FollowerInnen, die lebt nicht mein Leben, die spielt in einer ganz anderen Liga und jetzt will sie mir eine 3,95 Euro Handcreme verkaufen.Kristina Klein:
[7:16] Man wächst ja mit, also die Followerinnen und Follower wachsen ja mit der Influencerin und dem Influencer. Warum dieses, dass so gut funktioniert, ist, das nennen wir in der Forschung parasoziale Beziehung. Und das kennen wir eben auch aus, deswegen ist das immer alles nichts Neues,Kristina Klein:
[7:34] Das kennen wir auch schon sozusagen aus Filmen mit Schauspielerinnen und Schauspielern, wo wir das Gefühl haben, das sind unsere Freunde und wir können mit denen irgendwie eine Beziehung aufbauen. Die sind so wie du und ich. Das muss man sich ja nur mal vor Augen führen. Das sind Menschen, die haben 100.000, 200.000 Millionen Follower. Ganz ehrlich, die wissen nicht, wer wir sind. Aber wir haben das Gefühl, dass das so ist. Weil die auch mit uns sprechen. Und vielleicht geben die uns sogar mal ein Like auf eine Nachricht, die wir schreiben oder die schreiben uns zurück. Aber die Frage wissen wir erstens nicht, sind die das überhaupt, die uns zurückschreiben? Sind das nicht professionell gemanagte Kanäle, wo eben dann tatsächlich eine Agentur dahinter steht? Aber das ist sozusagen auch dieses Geheimnis. Und wenn wir sozusagen mit denen wachsen, ist diese psychologische Bindung so stark, dass wir das gar nicht so richtig hinterfragen, ob das jetzt eine 3,50 Euro Creme ist. Aber eigentlich könnte die sich jedwedes andere Produkt auch kaufen. Und dann ist es auch wieder eine Frage des Storytelling, wo man dann sagt, naja, guck mal hier, die Marke hat hervorragende hochqualitative Produkte und ist dabei tatsächlich auch günstig oder jeder kann sich die leisten. Das ist auch dann immer die Frage, wie es eingebunden wird. Welche Argumente mir da gegeben werden und dann sind wir ganz klassisch immer im allgemeinen Teil der Werbung. Also welche Art von Werbeansprache funktioniert, welche Botschaften funktionieren und so weiter.Patrick Lohmeier:
[8:58] Kann man dem eher mehr oder weniger oder ungefähr gleich viel Glauben schenken wie klassischen Werbebotschaften auf einer Litfaßsäule oder im linearen Fernsehen, die dann im Werbeblock ausgespielt werden? Oder ist das tendenziell eher mit mehr Risiken verhaftet, wenn ich sage, ich schenke dieser Influencerin, diesem Influencer mein Vertrauen, das wird schon alles richtig so sein?Kristina Klein:
[9:20] Naja, sagen wir mal so, im Prinzip bewegen sich ja alle im gleichen gesetzlichen Rahmen. Das heißt, es gibt ja bestimmte gesetzliche Regelungen, was ich darf oder nicht darf, welche Art von Versprechungen ich machen darf, welche Art von Informationen ich zur Verfügung stelle und so weiter.[CLIP]
Kristina Klein:
[9:50] Ja, dem werden natürlich, wie gesagt, was ich ja zu Beginn gesagt habe, die kriegen ein Briefing und die wissen auch, dass sie nicht lügen dürfen und keine Unwahrheiten erzählen dürfen. Aber das ist halt in diesem Problem, in diesem ganzen Themenkomplex ist so ein bisschen auch dieses Thema Kontrolle von externen Instanzen. Also es gibt ja tatsächlich so ein paar prominente Beispiele, wo Influencer und Influencer auch abgemahnt wurden, weil sie eben nicht offengelegt haben, dass es eben Werbung war, obwohl sie es hätten tun müssen oder dass da eben kommerzielle Interessen sozusagen diese Posts geleitet haben. Und da gibt es auch Urteile, die zu unterschiedlichen Entscheidungen kommen. Also noch nicht mal die Gerichtsbarkeiten sind sich da offenbar einig. Es kommt drauf an, mal so, mal so. Das Gericht hat festgehalten,[CLIP]
Kristina Klein:
[11:03] Und insofern wäre ich da immer ein bisschen vorsichtiger, aber auch jede Werbung, die man sieht. Unternehmen geben nur positive Argumente, warum man die eigenen Produkte und Services kaufen sollte. Im Prinzip ist ja Werbung immer mit einer gewissen Vorsicht zu genießen.Patrick Lohmeier:
[11:25] Was Kristina Klein hier aus ihrer Forschung zum Online-Marketing berichtet, das haben mir die Stimmen aus den Verbraucherzentralen und die von anderen gemeinnützigen InteressenvertreterInnen für den Verbraucherschutz bestätigt. Will heißen, ja, eigentlich gibt es Regeln und Gesetze, aber, ich meine, wir hatten das jetzt schon drei, vier, zehnmal in dieser Reihe. Da werden vermeintlich echte Erfahrungsberichte von Followern zitiert, weil man selber dafür keine Heilversprechen tätigen darf. Im Falle von mehr oder weniger seriösen Newsportalen setzt es dann Rügen, statt dass es Geldstrafen hagelt. Und naja, so ein alternativ-medizinisches Gadget muss gemäß gesetzlicher Vorgaben streng genommen gar nichts können, solange es nur keinen gesundheitlichen Schaden verursacht. Und versuchen sie da mal Rechtsansprüche geltend zu machen oder auch nur auf eine Retoure zu bestehen. Oder man gibt sich gar nicht erst die Mühe, sich an der Gesetzgebung zur Online-Werbung vorbei zu mogeln und ignoriert einfach bestehendes Recht. So geschieht es zumindest gemäß einer Studie von Foodwatch täglich in werblichen Storys rund um Nahrungsergänzungsmittel bei Instagram. Laut der Studie enthalten nämlich rund ein Drittel davon gesundheitsspezifische Aussagen mit unzulässigen Werbeversprechen.Patrick Lohmeier:
[12:47] Foodwatch-Geschäftsführer Chris Mettmann formuliert das mal ganz undiplomatisch. Ich zitiere: "Was sich in sozialen Medien abspielt, ist der wilde Westen der Gesundheitswerbung. Ohne Kontrolle, ohne Regeln, ohne Rücksicht auf Risiken." Zitat Ende. Genau, Heilversprechen im Zusammenhang mit Supplements, das geht gar nicht. Aber naja, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Folgen her. Deswegen nochmal kurz zur Gedächtnisstütze. Nahrungsergänzungsmittel sind keine Arzneiprodukte, sondern was genau?Angela Clausen:
[13:17] Nahrungsergänzungsmittel sind Lebensmittel. Lebensmittel wie Brot und Gurken. Und es gelten genau dieselben Gesetze wie für Brot und Gurken. Sprich, sie müssen sicher sein. Also sie dürfen nicht krank machen oder ähnliches. Aber sie sollen auch nichts Besonderes können. Sie sollen einfach nur mein Essen sein.Patrick Lohmeier:
[13:35] Danke, Angela. Und leider, leider, leider muss ich Ihnen mitteilen, dass die Unternehmen, die uns etwas verkaufen wollen, längst ein heißes digitales Eisen im Feuer haben, falls sie die Kontrolle über ihre menschlichen Werbegesichter endgültig verlieren. Genau. Influencerinnen und Influencer, Version 2.0.Kristina Klein:
[13:53] Also dieses Targeting von Leuten, das können natürlich irgendwie so Algorithmen schon besser als der Mensch. Genau, Zielgruppen erkennen, wem ich was ausspiele und auch eben, was ich über andere lernen kann und verarbeiten kann, das können natürlich Algorithmen besser, viel besser an einem höheren, skalierten Bereich tatsächlich, als der Mensch das kann. Aus der Forschung weiß man halt, dass bestimmte Dinge auch gut funktionieren, wenn die auf sehr aktuelle Dinge reagieren. Also, dass man irgendwie witzige,Kristina Klein:
[14:23] Werbung macht. SIXT war ja so ein Beispiel, die das im Offline-Bereich ganz gut gemacht haben, wenn irgendwie Skandale waren oder wenn irgendwie irgendeinem Prominenten irgendwas passiert ist in einem Politiker, dann haben die natürlich am nächsten Tag da irgendwie riesige großflächige Dinge rausgehauen oder hat dann halt die Republik drüber gesprochen und das ist dann gut, weil das ist halt quasi umsonst Werbung, wenn über einen gesprochen wird in positiver Art und Weise. Und diese Sachen machen natürlich Algorithmen und KI jetzt schneller und können auch schneller Trends erkennen, als das vielleicht Menschen können. Und da kann man dann vielleicht auch schneller sozusagen besser funktionierende im Sinne von besserer Ansprache, dass man darüber spricht, dass das passiert. Eine ganz spannende Entwicklung finde ich jetzt, wenn man KI und Influencerinnen-Marketing kombiniert. Es ist immer noch ein Nischentrend, aber ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Das sind die virtuellen InfluencerInnen. Die jetzt in Deutschland gibt es ein paar tatsächlich, aber sozusagen in den USA gibt es wirklich auch ganz große Accounts mit Millionen von FollowerInnen und das ist ja insofern für Unternehmen super spannend, weil Menschen hat man nicht unter Kontrolle, weil jedem kann mal irgendwas passieren und in irgendeinem Moment wird man erwischt, mit dem man vielleicht nicht ganz so glücklich war. Aber virtuelle InfluencerInnen, die hat man ja komplett im Griff. Die kann ich gestalten, was ich mit denen sozusagen möchte. Die können auch auf den Mars fliegen, die können jetzt hier sein, morgen da. Die sind ja mittlerweile so, auch von der Anmutung her, die sehen ja wirklich aus, auch tatsächlich, wenn die gut gemacht sind. Da muss man dreimal hingucken, dass man die von realen Menschen unterscheiden kann. Und das transparent gemacht,Patrick Lohmeier:
[16:09] Also kenntlich gemacht?Kristina Klein:
[16:10] In der Bio steht es. Ich bin mir nicht so sicher. Da gibt es ganz viel Forschung zu, dass das schwierig ist, für Menschen teilweise das zu erkennen. Und dass das auch negative Effekte haben kann, wenn Leute das dann plötzlich merken, dass das gar kein Mensch war. Ja, aber das ist so ein Feld, das finde ich jetzt ganz spannend, was da passiert und was da sich für Potenziale tatsächlich auch auftut.Patrick Lohmeier:
[16:40] Ich finde das Wort Potenziale hier sehr aussagekräftig, weil es wirklich gut auf den Punkt bringt, warum wir bei unserer Betrachtung von Online-Werbung möglichst alle Einflüsse berücksichtigen müssen, um ihr aufgeklärt und kritisch zu begegnen. Und dazu gehört eben auch, dass wir anerkennen oder erkennen sollten, dass das, was ich und meine GesprächspartnerInnen hier als Risiken für den Verbraucherschutz wahrnehmen, für profitorientierte Unternehmen und Influencer Potenziale darstellen, also Chancen und Möglichkeiten, ihre Produkte noch zielgruppengerechter und effektiver zu gestalten, bewerben und zu verkaufen. Es geht weniger darum, dass sich Unternehmen und Influencer, solange sie sich in einem gesetzlichen Rahmen bewegen und ärgern wollen, sondern die wollen einfach Geld verdienen. Und dazu gehört eben auch der Gebrauch von Nutzerdaten zur Anzeige maßgeschneideter Werbeangebote, die die meisten von uns mittlerweile nur noch als eine Art weißes Rauschen im Hintergrund wahrnehmen. Man kennt das alles, wenn man in den letzten 20 Jahren online war. Die Sprüche-Shirts und Tassen bei Facebook oder die Werbeanzeigen für genau den Fernseher, den man in der Woche zuvor noch gegoogelt hat und und und.Patrick Lohmeier:
[17:59] Und ja, dann wäre da noch die in vielerlei Hinsicht große Unbekannte "Künstliche Intelligenz", die hierzulande in der Online-Werbung bislang vor allem für die Kommunikation extremistischer politischer Standpunkte missbraucht wurde und um prominenten Werbeaussagen für betrügerische Angebote in den Mund zu legen.[CLIP]
Patrick Lohmeier:
[18:35] Solche eher schlecht als recht gemachten Deepfakes und KI-Kreaturen, nenne ich sie mal, sind noch kein großes Thema für die seriöse Werbeindustrie. Aber das liegt wohl vor allem an der Akzeptanz digitaler Werbebotschafter, also Influencer durch das zahlende Publikum, als an den technischen Möglichkeiten. Die sind nämlich gegeben. Und wenn schon Influencer aus Pixeln und Daten, dann muss das aktuell zumindest noch ironisch kommentiert werden, wie hier in einem Werbespot des Livestreaming-Superstars Montana Black für sein Energydrink. ...[CLIP]
Patrick Lohmeier:
[19:19] Aber mit einer kleinen Klammer um die Fake-Promis und Fake-Gewinnspiele bei YouTube und Facebook, also keine klassische Online-Werbung, mit der ich die Recherche zu dieser Podcast-Reihe begonnen habe, ist eben doch mit Blick auf die Basics werblicher Inhalte im Netz so ziemlich alles altbekannt. Es gibt das zu verkaufen, das Produkt wird eben gesetzlich gerade noch so akzeptablen Rahmen angepriesen und in der Regel präsentiert von Menschen, deren Leben wir uns wünschen oder ihnen nacheifern wollen oder eben deren Leben und Bedürfnisse unseren sehr ähnlich sind. Also entweder diese Wishful-Identification, von der Professorin Klein sprach, beispielsweise George Clooney trinkt in teuren Hotels Instant-Kaffee und Natalie Portman nibelt sich am Traumstrand mit Parfum ein, oder Similarity-Identification, weil die Werbegesichter uns so ähnlich sind. Das war vielleicht in der Fernsehwerbung früher die Familie am Frühstückstisch, die begeistert über einen Brotaufstrich oder eine Baufinanzierung oder eine Rabattaktion diskutierte. Eine Generation später ist der Typ wie du und ich eben der YouTuber, der seine Limo- und Anlagetipps verkaufen will. Oder die digitale beste Freundin bei Instagram, die genau unter den gleichen Alltagsproblemen leidet wie du und dafür garantiert eine kostenpflichtige Lösung in ihrem Onlineshop anbietet.[CLIP]
Patrick Lohmeier:
[21:05] Aber der größte Unterschied zu unserem Werbekonsum damals und heute ist, wir verbringen einfach so viel mehr Zeit online als damals vor dem Fernseher oder Radio oder mit der Zeitschrift. Gut anderthalb Stunden tummelt sich der durchschnittsdeutsche Nutzer oder die durchschnittsdeutsche Nutzerin auf fünf Social-Media-Accounts täglich. Bei Kindern und Jugendlichen zwischen 10 und 17 sind es sogar gut zweieinhalb Stunden. Und dafür ist der Austausch mit dem Freundeskreis und der Familie noch immer der wichtigste Anlass. Aber schon auf Platz zwei steht das Online-Shopping, also die Suche nach Marken und Produkten.Patrick Lohmeier:
[21:42] Erschwerend kommt hinzu, rot die Hälfte aller Menschen unter 40 vertrauen gemäß einer aktuellen repräsentativen Studie Videos und Posts in sozialen Netzwerken mehr als etablierte Nachrichtenmedien. Und das ist jetzt eine ganze Menge Zahlen, aber zusammengefasst könnte man auch sagen, wir leben in einer endlos langen Werbepause. Und wir sind geneigt, den Menschen und den Botschaften und den Unternehmen, die dort zu uns sprechen, immer mehr zu vertrauen. Diese Wirklichkeit anzuerkennen hat nichts damit zu tun, jetzt in Kulturpessimismus zu verfallen und zu jammern und zu hoffen, dass alles bald wieder so gut wird, wie es früher nie war. Nein, stattdessen gilt es, wachsam zu sein vor den unseriösen Verlockungen des Internets. Aber auch und noch wichtiger, Politik und Wirtschaft in die Pflicht zu nehmen, unsere Konsumenteninteressen zu schützen. Und da gilt, was Luise Molling von Foodwatch mir zu ungesunden Lebensmitteln sagte, eins zu eins für Online-Werbung. Nämlich, als Verbraucherinnen und Verbraucher sind wir eine schützenswerte Spezies, die sich nur sehr bedingt selbst gegen die Macht kommerzieller Anbieter und Märkte schützen kann.Luise Molling:
[22:49] Die eben durch die Ernährungsweise zustande kommen. Wir ernähren uns einfach insgesamt sehr schlecht. Und meine Kampagnen-Themen, bei meinen Themen geht es halt darum, wie wir gesündere Ernährungsumgebung schaffen oder wie wir es im Alltag schaffen, uns gesünder zu ernähren. Und das eben nicht dadurch, dass wir den Einzelnen aufklären, also wie das aus konservativen Kreisen eben gerne immer wieder angebracht wird. Also wir brauchen nur mehr Ernährungsbildung. Wir müssen den Kindern nur öfter beibringen, wie man jetzt kocht und den Schulfachernährung und dergleichen. Also diese Strategie, man nennt das sogenannte Verhaltensprävention, die gilt eigentlich unter Expertinnen schon seit 10, 20 Jahren als komplett gescheitert. Also das Problem ist nicht, dass wir nicht wissen, was gesunde Ernährung ist, sondern das Problem ist, dass wir uns nicht ernähren können, weil wir eben in der Umgebung leben. die uns diese gesünderen Kaufentscheidungen sehr schwierig macht. Und das fängt zum Beispiel an bei der Auswahl im Supermarkt, also dass fast sämtliche Produkte gesüßt sind, dass es fast keine Getränke gibt, die nicht eben sehr stark gesüßt sind. Das geht weiter mit dem Essen, was uns in Kantinen, in der Schule, in der Kita und so weiter serviert wird, das meistens sehr ungesund und einseitig ist. Und es hat auch eine ganz große Rolle, spielt eben auch die Werbung. Also welchen Einflüssen sind wir ausgesetzt? Was sehen wir für Werbung für Lebensmittel? Und was sehen zum Beispiel die Kinder auf den Plakaten in den sozialen Medien oder eben im Fernsehen, was hören sie im Radio für Werbung für Lebensmittel und das ist eben auch fast ausschließlich Werbung für ungesunde Lebensmittel.Patrick Lohmeier:
[24:12] Okay, dann nach all den Hiobsbotschaften, die wir in dieser Staffel von Dürfen die das verkünden mussten, bitteschön Tipps und vor allem politische Forderungen nach einem Ausweg aus dem Online-Werbewahnsinn. Meine Kollegin Ernährungswissenschaftlerin Britta Schautz hat dazu auf jeden Fall schon mal ein paar ganz schlaue Ideen und handfeste Wünsche an die da oben.Dr. Britta Schautz:
[24:34] Was ich mir als erstes wünschen würde, wäre eine bessere Zusammenarbeit der Behörden und nicht, ich mache nur meine Zuständigkeit und die geht bis zu dieser Grenze und dann denke ich nicht weiter. Ich wünsche mir da eine Vernetzung zwischen allen Akteuren, dass wir da gemeinsam zusammenarbeiten, damit Verbraucherinnen und Verbraucher eben geschützt werden. Denn das hilft uns allen, wenn nicht die Menschen Geld für Sachen ausgeben, die sie nicht brauchen oder sich vielleicht sogar noch gesundheitlich schädigen durch solche Sachen. Denn also auch eine ganz krasse Nummer, die wir mal hatten, da hat jemand geworben mit Guanabana-Pulver. Guanabana ist die Stachelanone, musste ich erst mal googlen, wusste ich nicht. Und dieses Pulver soll stärker wirken als jede Chemotherapie. Ja, und was ist, wenn jemand denkt, ja, ich möchte keine Chemotherapie mehr machen, die tut mir nicht so gut, nimmt dann dieses Zeug und stirbt an seiner Krebserkrankung, weil die Chemotherapie hat er dann abgesetzt.Patrick Lohmeier:
[25:26] Okay, ich bin grenzwertig schockiert.Dr. Britta Schauz:
[25:29] Ja, kann ich verstehen.Patrick Lohmeier:
[25:30] Also das Nahrungsergänzungsmittel, was klassifiziert ist als Lebensmittel, also beworben werden darf wie Lebensmittel ohne irgendeine medizinische Prüfung, von dem behauptet wurde, es tötet Krebszellen ab, Tumore.Dr. Britta Schautz:
[25:43] Ja, genau so wurde das behauptet. Und ich meine, das muss ja ein Interesse sein von allen, dass solchen Menschen, die das verkaufen, dass da ein Riegel vorgeschoben wird. Das heißt, wenn alle Behörden vielleicht ein bisschen aktiv dagegen vorgehen würden, das fände ich schon mal gut. Aber auch die Gesetzeslage finde ich schwierig. Dass wir dann jetzt erstmal den Influencern das nachweisen müssen, dass sie von dem und dem bezahlt werden und dass man sich da immer so rausreden kann, das ist total unbefriedigend. Also grundsätzlich muss der Internethandel besser kontrolliert werden. Wir brauchen kurze Hierarchien, wenn es um irgendwelche Regeln geht, um die Durchsetzung. Und was aber auch ganz wichtig ist, ist, dass wir zum Beispiel bei der Health Claims Verordnung, die ich schon erwähnt hatte, die war eigentlich als ein größeres Paket gedacht.Patrick Lohmeier:
[26:31] Ist das eine EU-Verordnung?Dr. Britta Schautz:
[26:32] Das ist eine EU-Verordnung, die regelt ja gesundheits- und nährwertbezogene Angaben. Und eigentlich sollte die Voraussetzung sein, dass ein Lebensmittel mit einer gesundheitsbezogenen Angabe nur werben darf, wenn es bestimmte Nährwertprofile einhält.Patrick Lohmeier:
[26:46] Ich mag das Wort eigentlich in solchen Sätzen nicht. Genau.Dr. Britta Schautz:
[26:49] Eigentlich ist hier nämlich auch das große Problem. Nährwertprofile hätten geheißen, dass zum Beispiel die Lebensmittel nicht zu salzig sein dürfen, nicht zu süß sein dürfen. Und das wurde nicht mit verabschiedet, weil es so schwierig ist, diese Nährwertprofile zu entwickeln. Aber das führt dazu, dass man selbst auf besonders zuckrigen Lebensmitteln immer noch drucken kann "Guck mal, da ist jetzt Vitamin C drin." Und das finde ich total schwierig. Also wenn wir das hätten, diese Nährwertprofile, die jetzt schon den, weiß ich nicht, 15. Nichtgeburtstag feiern. Also sehr, sehr lange wurden sie schon nicht eingeführt. Vielleicht sind es auch zehn Jahre, aber auf jeden Fall viel zu lange. Aber wenn wir die hätten, hätten wir schon mal deutlich weniger Wildwuchs an solchen Aussagen, weil das schon mal strenger reguliert wäre und auch sinnvoll. Und wir brauchen auch mehr Regeln für Nahrungsergänzungsmittel. Im Moment ist es ja so, die Anbieter dürfen es auf den Markt bringen, sie müssen es nur anmelden. Aber was damit völlig untergeht, ist die ganze Werbung dazu. Also ich fände es sinnvoll, wenn auch die Werbung dazu, der ganze Auftritt, das Etikett einmal angeguckt werden würde. Ist das so in Ordnung? Ist das nicht in Ordnung? Und möglicherweise auch eine Zulassungspflicht für Nahrungsergänzungsmittel. Oder zumindest Höchstmengen, sodass man sich wenigstens mit den Produkten nicht so sehr schaden kann.Patrick Lohmeier:
[28:02] Wäre da so ein Disclaimer, wie wir ihn für Arzneimittel haben, den wir auch schon seit Jahr und Tag aus der Fernsehwerbung und auch Online-Werbung kennen? Von wegen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker vor der Einnahme?Dr. Britta Schautz:
[28:13] Ich weiß nicht. Es steht ja schon drauf, Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung. Das steht schon drauf.Patrick Lohmeier:
[28:19] Ja, das steht irgendwo drauf, ganz klein auf der Packung. Aber das sagt natürlich jetzt nicht ein großer Influencer mit drei Millionen Followern, der das seinen Followern und Followern verkaufen möchte.Dr. Britta Schautz:
[28:28] Nö, genau.Patrick Lohmeier:
[28:29] Der oder die sagt einfach nur, danach geht es dir besser. Oder trink den Energy Drink, um mit Sekt zu gehen von Nahrungsergänzungsmitteln und dann bist du fitter und kannst die ganze Nacht durchzocken.Dr. Britta Schautz:
[28:38] Durchzocken, das könnte sogar klappen. Wenn da genug Koffein drin ist, ist es nur die Frage, ob das so gut ist. Ja, aber so ein Disclaimer weiß ich nicht, ob das wirklich abschreckt. Also ich glaube wirklich, dass vorher schon guckt werden sollte, wie darf das überhaupt beworben werden. Das wäre schon sinnvoll.Patrick Lohmeier:
[28:53] Strengere gesetzliche Auflagen und Kontrollen zu dem, was Online-Werbung darf und zu vielem, was drin ist in den Produkten, die uns verkauft werden sollen, die wären nicht nur gut für Konsumentinnen und Konsumenten, sondern würden auch uns in den Verbraucherzentralen die Arbeit erleichtern.Patrick Lohmeier:
[29:10] In einer perfekten Welt müssten nicht erst hunderte enttäuschte Kundinnen in den Rechtsberatungen der Verbraucherzentralen ausschlagen und sich über teure Glasperlen beschweren. Oder die körperliche Gesundheit ahnungsloser Menschen durch ein Esoterik-Gadget oder ein fragwürdiges Nahrungsergänzungsmittel gefährdet sein. Damit die Verbraucherzentralen Anbieter abmahnen und ihnen damit im Erfolgsfall die Werbung und den Vertrieb solch eines Angebots untersagen können. Es besteht kein Zweifel daran, diese Abmahnungen sind ein probates Mittel gegen unseriöse Geschäftemacher. Aber oft eben erst, wenn das sprichwörtliche Kind in den ebenfalls sprichwörtlichen Brunnen gefallen ist. Sprich, ein fragwürdiges Produkt oder eine Dienstleistung ist schon seit Wochen oder Monaten auf dem Markt und hat bereits erheblichen Schaden an der Gesundheit und den Geldbeuteln von Kundinnen angerichtet, bevor wir eingreifen können. Aber wenn beim Verbraucherschutz im Online-Konsum seitens der Politik und Rechtsprechung noch viel nachzuholen ist, gibt es denn wenigstens berechtigte Hoffnung, dass die profitorientierten Influencer, Marken und die Konzerne dahinter vielleicht irgendwann mal sowas wie ein Gewissen entdecken und auf das schnelle Geld zugunsten mehr Transparenz und Ehrlichkeit in der Online-Werbung verzichten?Patrick Lohmeier:
[30:27] Okay, zugegeben, die Frage ist überspitzt und dieses Szenario äußerst unrealistisch. Doch wie sieht es denn aus mit dem positiven Ausblick darauf, dass Abmahnungen und Warnungen und die Berichterstattung von gemeinnützigen Organisationen wie den Verbraucherzentralen oder Mimikama oder Netzpolitik.org ein Umdenken in den großen Marketingabteilungen dieser Welt bewirken konnten? Na gut, ein Versuch war es wert. Ich habe die Frage zumindest all meinen Gesprächspartnerinnen in den letzten Wochen gestellt und die Antworten reichten vom erwarteten nervösen Räuspern über amüsiertes Lächeln bis zum absoluten Stillschweigen. Nur Luise von Foodwatch fiel dazu was ein.Luise Molling:
[31:07] Also eine direkte Reaktion auch auf unsere Anfragen kam eigentlich nie, auch auf unsere Kritik nicht. Vereinzelt, wenn Journalisten natürlich dann angefragt haben, aufgrund unserer Berichterstattung kam dann schon mal eine Reaktion. Meistens eben ausweichend in Richtung, ja, wir haben hier unsere Standards XY und die befolgen wir. Und unser Zielpublikum, also wie die Energy Trink-Verband ja immer gern sagen, sind eigentlich junge Erwachsene. Das ist quasi alles nur Kollateralschaden, dass man dort auch die ganzen Kind-Minderjährigen erreicht hat. Und das Einzige, was wir halt erlebt haben, ist zum Beispiel nach dem Junkfluencer-Report. Also da waren zwei sehr prominente Figuren drin, Influencerinnen drin. Vicky und Sarina, kann ich auch mal nennen, wer die sich mal anschauen möchte. Und die haben damals fast ausschließlich Junkfood-Werbung gemacht. Also wirklich reihenweise. Und der ganze Kanal bestand eigentlich nur aus darin, dass sie Süßigkeiten essen.Luise Molling:
Und jetzt essen sie immer noch viel Süßigkeiten, aber jetzt zumindest scheinen sie nicht mehr so viel dafür bezahlt zu werden, also weniger offizielle Werbung zu machen. Also da scheint die Berichterstattung schon auch was bewirkt zu haben. Ich weiß nicht, ob es jetzt die kritische Selbstreflexion war oder ob sie dann doch realisiert haben, vielleicht ist nicht so gut, wenn wir halt vor allem Minderjährige ansprechen und die machen halt wirklich, also das ist eine kitschige Pferdewelt mit Hunden und alles rosa und Glitzer und sie verkaufen Schulkalender und Schulprodukte, genau, Schlafanzuge für Kinder, also die sind wirklich nachweislich, die machen auch so Events, wo man sieht, dass halt fast nur 8- bis 12-jährige Mädchen da im Publikum sitzen, die haben wirklich ein sehr, sehr junges Zielpublikum und vielleicht war es ja dann doch ein bisschen selbsterkennend, ein bisschen kritische Reflexion, dass sie das inzwischen ja zumindest nur noch selten und weitaus weniger machen, als sie es damals gemacht haben. Aber da hat es zumindest ein bisschen Wirkung gehabt anscheinend.
Patrick Lohmeier:
[33:03] Am Ende des Tages und dieser Podcast-Reihe kann man Werbeträgerinnen wie Viktoria und Sarina eben nur vor den Kopf schauen. Aber letztendlich kann und sollte es uns auch egal sein, warum YouTuberinnen und YouTuber mit einer jungen Zielgruppe nun einmal seltener vor der Kamera Junkfood in sich reinschaufeln. Oder wie in diesem Fall unentgeltlich eine Schokobombe aus Ferrero-Produkten bauen oder für den schnürten Mammon an anderer Stelle becherweise rohen Keksteig mit ihrem Logo drauf verputzen. Ja, und wenn es jetzt nicht gerade der unfassbar gute Rabatt oder das einmalige, exklusive und fast vergriffene Angebot ist, das uns dazu verlockt, auf Online-Werbung zu klicken und zu tippen, dann sind es meist genau diese parasozialen Beziehungen zu Influencern, die genau dafür sorgen.Patrick Lohmeier:
[33:57] Parasoziale Beziehungen in sozialen Netzwerken, das beschreibt grob gesagt unsere persönliche Gefühlslage zu einem prominenten Menschen. Und dass wir uns in einem Promi wiedererkennen und ihm oder ihr nacheifern wollen und über diese Sehnsucht etwas verkauft wird, das ist ja beinahe so alt wie die Werbung selbst. Beispiele aus vergangenen Jahrzehnten gibt es da genug. Zum Beispiel hier den schicken Kleinwagen, den Franzi von Almsick durch Manhattan steuert. Ach ja, und wenn Manfred Krug ins Aktiengeschäft einsteigt, dann können wir das sicher auch. Und Salmiak-Katzen, die von Profifußballern gelobhudelt werden, die tun sicher auch meinem Magen gut. ...[CLIP]
Patrick Lohmeier:
[34:51] Danke. Ja, ja, alles ein alter Hut oder alte Hüte. Doch die maßgeblichen Unterschiede zwischen solchen Influencern aus dem analogen und dem digitalen Zeitalter sind die folgenden. Mit den Oldschool-Promis verbrachten wir 20 oder 30 Sekunden in einer Werbepause. Mit den Werbestars bei YouTube, Insta, TikTok und Co. verbringen wir heutzutage ein Vielfaches dieser Zeit. Und dann ist da noch der Unterschied, den dieser Begriff parasozial beschreibt. Wir als Konsumentinnen und Konsumenten verschaffen uns durch Likes, Shares, Kommentare und Abos den Eindruck, mit unseren Stars zu interagieren und fühlen uns ihnen dadurch näher. Eine Nähe, die es in der Realität und in der Regel schon gar nicht gibt. Denn die Kommunikation bleibt einseitig, die Liebe wird durch die Influencer nicht erwidert. Bestenfalls fällt gelegentlich mal ein Faith oder Like für uns ab, das uns im Gefühl bestätigt, Wir könnten unserem Star mehr bedeuten als all die anderen 100.000, 500.000, 3,5 Millionen Follower. Und so wird diese parasoziale Beziehung oder parasoziale Interaktion zum mächtigsten Instrument im Influencer-Marketing.Patrick Lohmeier:
[36:13] Dass unsere allzu menschlichen Bedürfnisse, ich möchte nicht sagen Schwächen, im digitalen Raum, in dem wir täglich viele Stunden unserer Freizeit verbringen, immer perfide ausgenutzt werden, um uns etwas zu verkaufen oder noch schlimmer, um uns übers Ohr zu hauen, das ist mittlerweile klar. Dagegen helfen nur gesunde Zweifel und Achtsamkeit. Und im Fall der Fälle die Verbraucherzentrale vor Ort. Ein Allzweck-Wundermittel gegen verführerische Online-Werbung wurde mir jedenfalls während der Recherche und der vielen Gespräche, die ich führen durfte, nicht empfohlen. Aber ich konnte sowas wie ein persönliches Fazit ziehen, das mir im Gespräch mit meiner Kollegin Britta kam.Werbeversprechen, von denen du vorhin schon sprachst, einfach Sachen, die nicht wissenschaftlich überprüfbar sind. Einfach, dass geworben wird mit Inhaltsstoffen, von denen neun von zehn oder wahrscheinlich sogar noch 99 von 100 Menschen nie gehört haben und denen nur aufgrund der Unwissenheit über diesen Zusatzstoff eine potenziell positive Wirkung zugeschrieben wird.
Dr. Britta Schautz:
[37:16] Ja genau, so ein bisschen kommen wir wieder zurück auf die Red Flags, dieses, das hat dir noch keiner gesagt, dass das so toll ist. Ja, wenn es wirklich so wäre, dann, ich glaube, dann wüssten wir das alle schon.Patrick Lohmeier:
[37:24] Ich finde, das harmoniert eben sehr gut, um mal hier so den Advokat des Teufels zu spielen, quasi diese Individualität des Werbesprechs, dieser Werbebotschaften, die vermittelt werden, eben innerhalb von YouTube-Videos zum Beispiel oder Insta-Stories, dass du einfach quasi das Programm stoppst und die Person, die du magst, der du folgst, irgendwas erzählt mit eben diesem, ja, dieser Individualitätsaspekt, dass du eben dann auch was zu dir nimmst, was eben nicht alle anderen zu sich nehmen. Wir haben da wahrscheinlich noch nie was von gehört, von diesen tollen Inhaltsstoffen, von irgendwelchen Algen. Ist ja komplett komisch, das kannst du nicht in der Apotheke kaufen, das muss ja cool sein. Also es passt schon sehr, sehr gut zusammen, dieser Individualitätsgedanke. Ja, wir wollen ja alle individuell sein.Dr. Britta Schautz:
[38:03] Genau, wir wollen alle ein bisschen speziell sein und das macht man ja heutzutage auch, ist ja auch total okay. Die Frage ist nur, ob es nicht vielleicht besser wäre, sich selber die Zeit zu nehmen und sich ein hochwertiges Essen selber zu kochen. Dann nehme ich mir ja auch Zeit für mich und das ist für den Körper auf jeden Fall eine gute Sache. Und ich spare wahrscheinlich richtig viel Geld dabei.Patrick Lohmeier:
[38:25] Da geht es zwar um gesundes Essen, aber ich versuche, den dazugehörigen Gedanken mal mitzunehmen. Also mitzunehmen in jede Lebenslage, in der mir im Netz eine Werbeanzeige oder ein Advertorial oder ein Influencer klar machen will, dass mein Lifestyle noch lange nicht so ausoptimiert ist wie der von irgendwelchen anderen Menschen da draußen. Menschen, die es vielleicht gibt oder auch nicht. Nämlich diesen Gedanken, dass ich nicht die vermeintlich beste Smartwatch oder ein faltenloses Lächeln und schon gar keine Algenkapseln und Glaskügelchen brauche, damit mein Leben ziemlich okay und vor allem einzigartig ist. Und das, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ist ihres ebenfalls.Patrick Lohmeier:
[39:24] Das war die letzte Folge der ersten Staffel von "dürfen Sie das?" rund ums Thema Online-Werbung. Ich hoffe, Sie hatten Spaß daran. Dieser Podcast wird veröffentlicht von der Verbraucherzentrale Berlin und gefördert durch das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Und er wird moderiert und produziert von mir, Patrick Lohmeier. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Menschen, die die Entstehung dieses Formats ermöglichen und mit ihrer Expertise unterstützen. Und natürlich bedanke ich mich herzlich bei Ihnen fürs Zuhören. Sollten Sie Fragen, Kritik, Ergänzungen oder Themenwünsche für kommende Staffeln von "dürfen, die das?" haben, schreiben Sie mir gerne an podcast@vz-bln.de. Diese und weitere Kontaktmöglichkeiten, Informationen und Quellenangaben finden Sie auch im Begleittext zu dieser Episode auf verbraucherzentrale.de oder in Ihrem Podcatcher. Also, Danke noch einmal fürs Zuhören und bis bald in diesem Podcast-Feed.
Bei Fragen, Kommentaren und Themenwünschen rund um den Podcast erreichen Sie Patrick Lohmeier per E-Mail an podcast@vz-bln.de.