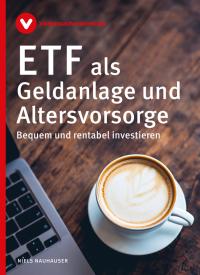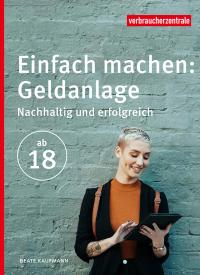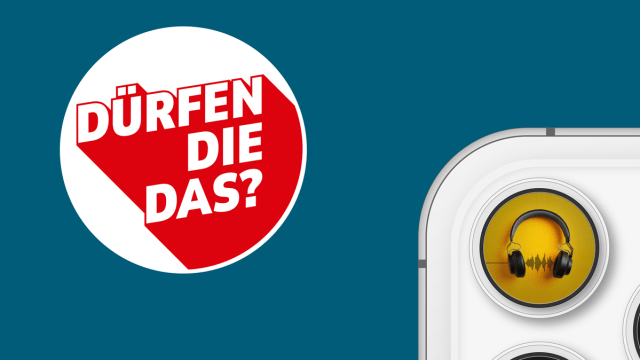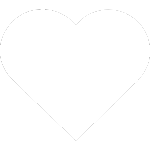Das Wichtigste in Kürze:
- Die Art der Replikation kann im Detail komplex sein, spielt bei der ETF-Auswahl aber keine zentrale Rolle. Für alle Methoden gelten dieselben rechtlichen Vorgaben.
- Dieser Überblick erklärt die Unterschiede und Funktionsweisen der gängigen Verfahren.
Vollständige Replikation: So funktioniert das klassische Nachbilden
Bei der vollständigen oder "physischen" Replikation hält der ETF sämtliche Wertpapiere, die auch im zugrunde liegenden Index enthalten sind – in exakt derselben Gewichtung.
Beispiel: Ein ETF auf den DAX enthält stets Aktien aller 40 im Index vertretenen Unternehmen. Die Gewichtung jeder Aktie im Fonds entspricht ihrer Gewichtung im Index.
Da sich die Zusammensetzung von Indizes regelmäßig ändert, passt der ETF sein Portfolio entsprechend durch Käufe und Verkäufe an. Das führt jedoch bei sehr breit aufgestellten Indizes wie dem MSCI World (über 1.300 Titel) oder dem Stoxx Europe 600 zu höheren Transaktionskosten als bei anderen Verfahren. Auch steuerliche Effekte – etwa durch Quellensteuern auf Dividenden – können die exakte Nachbildung erschweren.
Hinzu kommt: Viele ETF-Anbieter verleihen die im Fonds enthaltenen Aktien (Wertpapierleihe), um zusätzliche Erträge zu erzielen. Die Risiken sind gesetzlich reguliert: Ohne hochwertige Sicherheiten ist eine solche Leihe nicht erlaubt. Wie viel von diesen Erträgen den Anleger:innen zugutekommt, ist im Verkaufsprospekt geregelt.
Zwar können Sie bei einigen Vergleichsportalen ETFs mit "vollständiger Replikation" selektieren, allerdings ist diese Angabe oft falsch. Ausschlaggebend ist immer die Rechtsgrundlage, also der Verkaufsprospekt. Darin behalten sich die Fondsgesellschaften in der Regel umfangreiche Gestaltungsrechte vor, wie sie den Index nachbilden. In der Praxis gibt es für weltweite Indizes daher ausschließlich ETFs, die den Index mithilfe von Optimierungstechniken nachbilden.
Optimierte Replikation: Wenn bereits eine Auswahl reicht
Bei der optimierten Replikation (auch: Sampling-Methode) investiert der ETF nur in eine repräsentative Auswahl von Wertpapieren aus dem Index – und nicht in alle enthaltenen Titel.
Diese Methode wird bei allen sehr breit gestreuten Indizes wie dem MSCI All Country World Index (über 2.500 Aktien) oder FTSE All World (über 4.000 Aktien) eingesetzt. Durch den gezielten Verzicht auf einige, meist kleinere Aktiengesellschaften, die ohnehin ein minimales Gewicht im Index haben, kann der ETF die Wertentwicklung des Index dennoch nahezu vollständig nachbilden – bei deutlich geringeren Kosten.
Auch hier kann es zur Wertpapierleihe kommen, wie bei vollständig replizierenden ETFs.
Synthetische Replikation: Indexabbildung per Tauschgeschäft
Bei der synthetischen Replikation hält der ETF nicht die im Index enthaltenen Wertpapiere, sondern erreicht die Indexabbildung über ein Tauschgeschäft („Swap“) mit einer Bank.
Beispiel: Ein synthetischer ETF auf den DAX muss keine einzige DAX-Aktie enthalten. Stattdessen kann er etwa Anleihen oder Aktien anderer Unternehmen halten. Durch einen Swap-Vertrag verpflichtet sich eine Bank, dem ETF exakt die Wertentwicklung des DAX zu liefern. Im Gegenzug erhält die Bank die Rendite des tatsächlichen Fondsportfolios.
Solche Swap-ETFs können kostengünstiger sein, da sie weniger Transaktionen benötigen. Kritisiert wird gelegentlich die höhere Komplexität und das sogenannte Kontrahentenrisiko – also das Risiko, dass der Vertragspartner des Swaps (die Investmentbank) ausfällt. Dieses Risiko ist gesetzlich auf maximal 10 Prozent des Fondsvermögens begrenzt und wird durch Sicherheiten zusätzlich abgesichert.
Wichtig: Auch klassische Fonds nutzen häufig Derivate wie Swaps. Die Praxis ist also nicht auf ETFs beschränkt. Zudem gibt es bei den laufenden Kosten keine systematischen Unterschiede zwischen synthetisch und physisch replizierenden ETFs – da Swap-Kosten bzw. Einnahmen aus Wertpapierleihe bereits eingepreist sind.
In der Regel ergeben sich auch keine steuerrechtlichen Unterschiede, denn auch bei der synthetischen Replikation handelt es sich bei ETFs, die einen Aktienindex nachbilden, meist um Aktienfonds, die von der Teilfreistellungsquote von 30 Prozent profitieren, die für alle andere Aktienfonds ebenfalls gilt. Angaben dazu finden Sie stets im Verkaufsprospekt.
Was, wenn Aktienfonds keine Aktien halten?
Viele Anleger:innen sind überrascht, dass Aktienfonds – darunter auch ETFs – nicht zwangsläufig nur in Aktien investieren. Der Einsatz von Wertpapierleihe, Derivaten oder Swap-Vereinbarungen ist weit verbreitet und rechtlich zulässig. Nur wenige Fonds schließen solche Instrumente im Verkaufsprospekt ausdrücklich aus.
EU-weite Vorgaben begrenzen das Ausfallrisiko aus diesen Geschäften auf maximal 10 Prozent des Fondsvermögens. Dieses Risiko würde sich nur dann realisieren, wenn die hinterlegten Sicherheiten vollständig wertlos würden – ein Szenario, das selbst in der Finanzkrise 2008 nicht eingetreten ist.
Im Zuge der Investmentsteuerreform 2018 haben viele Fondsgesellschaften die Verkaufsprospekte ihrer Aktien-ETFs angepasst. Um die steuerliche Teilfreistellung von 30 Prozent auf Fondserträge zu sichern, investieren die meisten Aktien-ETFs nun mindestens 51 Prozent ihres Vermögens in Aktien. Diese Schwelle ist Voraussetzung für die steuerliche Einstufung als Aktienfonds.